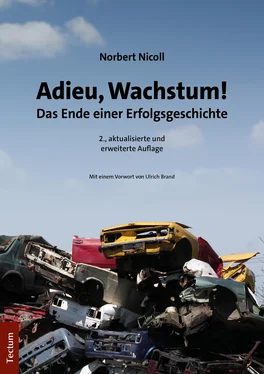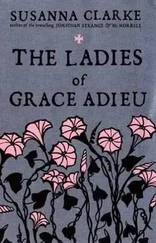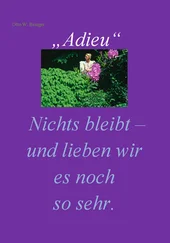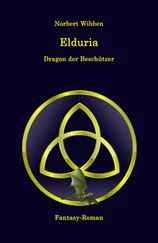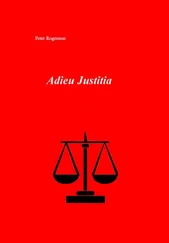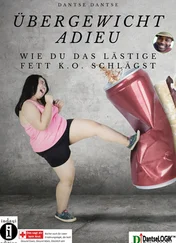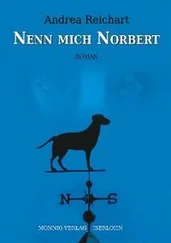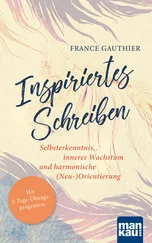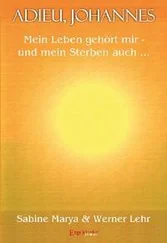Diese Entwicklung, von Marxisten als einfache Warenproduktion bezeichnet, beginnt mit der schon erwähnten Neolithischen Revolution vor 11.000 Jahren in Vorderasien. Lange Zeit tauschten bzw. verkauften die Bauern ihre Waren auf kleinen Märkten. Allerdings veräußerten sie ihre Waren, um damit andere Erzeugnisse erwerben zu können, die sie selbst nicht herstellten. Es ging darum, etwas zu verkaufen, um mit dem Erlös etwas kaufen zu können. Die Einführung des modernen Geldes erleichterte diese Transaktionen sehr. Mit dem Geld konnte sich aber ein neuer Menschentypus herausbilden: der Geldbesitzer, der Kapitalist. Im Unterschied zum obigen Beispiel des Bauern galt für ihn: Er kaufte, um zu verkaufen. Und im Unterschied zum Bauern war sein Ziel nicht Bedürfnisbefriedigung, sondern einen bestimmten anfänglichen Geldbetrag durch einen Gewinn zu vermehren. Immer reicher zu werden, war das erklärte Ziel seiner Tätigkeit.
Kapital – und hier ganz konkret Geldkapital – ist ein Wert, der sich in einer Art Endlosschleife des wechselseitigen Kaufens und Verkaufens immer weiter vermehrt. Wer Waren wie die Händler im Beispiel günstig kauft und zu einem höheren Preis verkauft, generiert einen Handelsgewinn.
Auf diesen Handelsgewinn zielten die ersten Aktiengesellschaften. Die erste ihrer Art war die Niederländische Ostindien-Kompanie, die im Jahr 1602 entstand. Aktiengesellschaften, rechtlich eine »juristische Person« 250, hatte es bis dato nicht gegeben. Vorher hing die Kapitalanhäufung an Einzelpersonen. Starben diese, so war es auch mit dem Streben nach Akkumulation vorbei. Aktiengesellschaften überdauern viele Generationen – hier ist die Akkumulation institutionalisiert. Anders formuliert: Aktiengesellschaften als ein zentrales Element des Kapitalismus werden von der Logik der endlosen Geldvermehrung angetrieben. Sie kennen keinen zu erreichenden und zu konservierenden Endzustand. Was zählt, ist unendliche Expansion. 251
Neben dem Handelsgewinn gibt es weitere Formen des Gewinns, am bekanntesten ist der Gewinn durch Mehrwertproduktion in den Fabriken. Diese Form des Gewinns hat niemand besser und präziser erklärt als Karl Marx.
Was ist Mehrwert?
Schon vor der Entstehung des Kapitalismus konnte man den Prozess der Produktion eines Gutes gedanklich in zwei Teile zerlegen: in ein notwendiges Produkt und ein Mehrprodukt.
Der Wert der Ware Arbeitskraft wird durch die Reproduktionskosten bestimmt, d. h. durch den Wert aller Waren, die zur Regeneration der Arbeitskraft verbraucht werden. Man kann sich fragen: Was ist nötig, um den Arbeiter in die Lage zu versetzen, die verbrauchten Kalorien und Vitamine wieder anzusammeln, die bei der Arbeit verlorengegangen sind? Und was ist nötig, um seine Familie zu ernähren? 252Diese Fragen sind entscheidend, um das sogenannte notwendige Produkt verstehen zu können.
Die herrschende Klasse eignete sich das Mehrprodukt an (im Wesentlichen durch Steuern und Frondienste), während die unterdrückten Klassen das notwendige Produkt verkonsumierten. Im Kapitalismus setzt sich diese Konstellation unter geänderten Vorzeichen fort: Vom Beginn des Arbeitstages an fügen die Arbeiter dem Rohmaterial neuen Wert zu. Nach einer bestimmten Zahl von Arbeitsstunden haben sie einen Wert erzeugt, der genau ihrem Tageslohn entspricht. Wenn sie ihre Arbeit in genau diesem Moment beenden würden, hätte ihr Arbeitgeber nichts an ihnen verdient. Aber genau das ist die Intention des Arbeitgebers: Er kauft Arbeitskraft ein, um etwas zu verdienen. Der Arbeiter muss deshalb noch einige Stunden länger arbeiten.
Die Substanz des Mehrwerts ist also Mehrarbeit, unbezahlte, vom Kapitalisten angeeignete Arbeit. Der Mehrwert kann entstehen, weil eine Differenz zwischen dem Wert besteht, den der Arbeiter produziert, und dem Wert der Waren, die er für seinen Unterhalt verbraucht. Diese Differenz wird möglich durch ein Wachstum der Arbeitsproduktivität. Der Kapitalist kann sich diesen Zuwachs aneignen, weil er die Produktionsmittel besitzt. 253
Arbeitskraft als Ware
Die Beziehung zwischen billiger Nahrung und dem Preis der Arbeitskraft ist äußerst wichtig. Der Preis für Nahrung bestimmt den Preis für Arbeitskraft. 254Außerdem wichtig: Kapital ist nicht zu verwechseln mit Kapitalismus. Kapital in dem gerade beschriebenen Sinne ist Tausende Jahre alt.
Für den Kapitalismus, verstanden als komplexes Wirtschaftssystem, gilt das nicht. Die entscheidende qualitative Veränderung ergab sich in Europa im »langen« 16. Jahrhundert (1450–1640).
Kapitalistisches Handeln bestimmte nun die Logik des Handelns. In Europa konkurrierten die verschuldeten Fürsten um mobiles Kapital, um damit Söldnerheere, Ausrüstung und Waffen bezahlen zu können. Die Medici und die Fugger stiegen auf. Wer am meisten Kapital anzog, konnte die stärksten Armeen ins Feld schicken und die meisten Territorien erobern. Und den Geldgebern einen gewaltigen Return on Investment auszahlen. Wer nicht mitmachte, wurde von der Landkarte radiert.
Staat und Großkapital begannen, ein undurchdringliches Geflecht zu bilden. So entstand die aggressive, auf endlose Expansion und Akkumulation angelegte Dynamik des Kapitalismus, die in den Kolonialismus mündete. 255
Gleichzeitig passierte noch etwas: Bis in das »lange« 16. Jahrhundert waren die Kapitalisten Händler, Geldverleiher oder Wucherer – manchmal alles zusammen. Doch nun dringen die Kapitalisten in die Produktionssphäre ein. Sie erwerben Produktionsmittel und stellen Arbeiter ein. Mehrwert wird damit im Produktionsprozess selbst erzeugt. 256
Arbeitskraft wird in diesem Moment in eine Ware verwandelt. Das ist, wie schon erwähnt, eine Besonderheit des kapitalistischen Systems. Das beschriebene Verhaltensmuster der Kapitalisten bleibt identisch: Sie kaufen, um zu verkaufen. Dieses Mal auch Arbeitskraft.
Nach Ernest Mandel gibt es drei Entwicklungen, die den Kapitalismus ermöglichten: Erstens die Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln. Zweitens die Bildung einer gesellschaftlichen Klasse, die die Produktionsmittel monopolisierte: die Bourgeoisie. Die Entstehung dieser Klasse setzte die Akkumulation von Geldkapital voraus. Zudem mussten die Produktionsmittel so teuer sein, dass nur reiche Bürger diese erwerben konnten. Und drittens durch die schon erwähnte Verwandlung der Arbeitskraft in eine Ware. Diese Verwandlung wurde erst dadurch möglich, dass eine Klasse von Menschen keinen Zugang zu Grund und Boden mehr hatte, sondern nur noch ihre Arbeitskraft besaß. Diese Arbeitskraft musste zu Markte getragen werden, um überleben zu können. 257
Die Erfindung der Arbeit
Es lohnt sich an dieser Stelle, den Begriff der Arbeit kurz zu reflektieren. Wir glauben heute, dass Arbeit so alt ist wie die Menschheit. Menschen mussten nach dieser gängigen Vorstellung immer arbeiten, um ihre Grundbedürfnisse befriedigen zu können. Doch das stimmt nicht. Arbeit in der Antike war das, was die Sklaven tun mussten. Alles andere waren Tätigkeiten, wie etwa die Besorgung von Brennholz, das Stillen der Kleinkinder oder das Waschen der Wäsche. Tätigkeiten waren selbstbestimmt und dienten dem eigenen Wohl bzw. nutzten der Gemeinschaft.
Mit der Herausbildung des Kapitalismus in der Neuzeit wurde alles zu Arbeit. Es ging darum, Menschen Zwecken zu unterwerfen, die außerhalb ihrer eigenen Motivation standen. 258Eine zentrale Voraussetzung dafür war die Uhr. Jener Schlüsseltechnologie kam eine entscheidende Rolle bei der Strukturierung von Leben, Raum und Natur zu.
Heute erscheint es uns selbstverständlich, dass jegliche Zeit bestmöglich verbraucht und genutzt werden will. Lediglich seine Zeit zu verbringen, gilt als anstößig.
Bis zur Einführung der Uhr hing die Länge des Arbeitstages von unterschiedlichen Tageslängen bzw. den Jahreszeiten ab. Die Uhr machte Schluss damit. In vielen Orten waren es zunächst die Stadtglocken, die Beginn und Ende einer Arbeitsschicht einläuteten. Ab dem 16. Jahrhundert erfolgte die Zeitmessung vielerorts dann auf Minuten und Sekunden genau mit der Hilfe von mechanischen Uhren. 259
Читать дальше