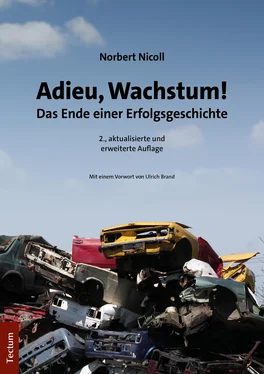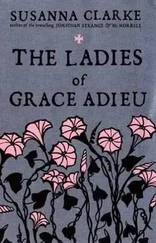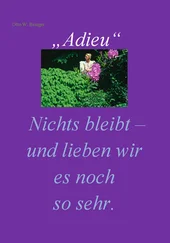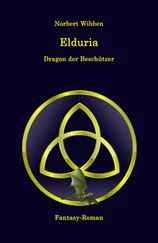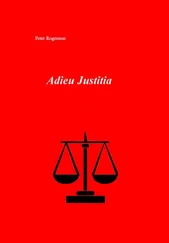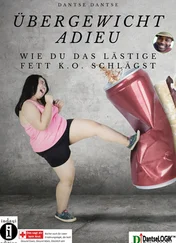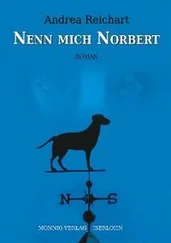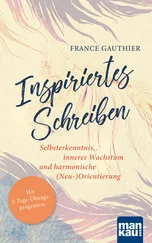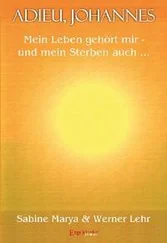160Vgl. Steffen, Will et al.: The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?, S. 614, in: Ambio, Vol. 36, Nr. 8, Royal Swedish Academy of Sciences, December 2007, S. 614–621.
161Vgl. Harari, Yuval Noah: Eine kurze Geschichte der Menschheit, 7. Auflage, München 2015, S. 22.
162Vgl. Liebsch, Thomas: Zivilisationskollaps, a. a. O., S. 304–305.
163Vgl. Harari, Yuval Noah: Eine kurze Geschichte der Menschheit, a. a. O., S. 36–41.
164Vgl. Sieferle, Rolf Peter: Lehren aus der Vergangenheit, S. 2. Text online unter: https://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu/publikationen/hauptgutachten/hg2011/pdf/wbgu_jg2011_Expertise_Sieferle.pdf[Stand: 2.6.2020].
165Vgl. Liebsch, Thomas: Zivilisationskollaps, a. a. O., S. 61–64.
166Vgl. o. V.: Die Entstehung der Landwirtschaft. Online unter: http://www.oekosystem-erde.de/html/erfindung_landwirtschaft.html[Stand: 30.5.2020].
167Vgl. Sieferle, Rolf Peter: Lehren aus der Vergangenheit, a. a. O., S. 2.
168Diamond, Jared: The Worst Mistake in the History of the Human Race, in: Discover Magazine, Mai 1987, S. 64–66. Den Text gibt es auch online unter: http://www3.gettysburg.edu/~dperry/Class%20Readings%20Scanned%20Documents/Intro/Diamond.PDF [Stand: 30.5.2020].
169Vgl. Harris, Marvin: Kannibalen und Könige. Aufstieg und Niedergang der Menschheitskulturen, Frankfurt am Main 1978, S. 19–25.
170Vgl. ebenda, S. 101.
171Vgl. ebenda, S. 29–32.
172Vgl. ebenda, S. 39–41.
173Vgl. ebenda, S. 15.
174Vgl. Montgomery, David: Dreck, a. a. O., S. 56.
175Vgl. Harris, Marvin: Kannibalen und Könige, a. a. O., S. 47–48.
176Vgl. Heinberg, Richard: Jenseits des Scheitelpunkts, a. a. O., S. 75.
177Der israelische Historiker Yuval Noah Harari sieht in diesem Umstand eine gigantische Fehlkalkulation. Mehr Nahrung sorgte für mehr Geburten. Mehr hungrige Kinder machten allerdings wieder mehr Ernten und mehr Arbeit erforderlich. Der an sich positive Effekt der veränderten Lebensweise wurde in vielen Erdregionen überkompensiert. Die Menschen arbeiteten seiner Ansicht nach härter, lebten durch die rasant anwachsende Bevölkerung aber schlechter. Vgl. dazu Harari, Yuval Noah: Eine kurze Geschichte der Menschheit, a. a. O., S. 112–113.
178Vgl. Abelshauser, Werner: Die Erfindung des Eigentums, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 31. Januar 2010, S. 40.
179Für Cicero gab es drei wesentliche Erklärungen für Privateigentum: erstens frühe Inbesitznahme (durch die Ersten, die in unbesetzte Gebiete kamen), zweitens durch Eroberungen bei kriegerischen Auseinandersetzungen und drittens durch Gesetze, Verabredungen oder Verträge.
180Vgl. Scheidler, Fabian: Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation, Wien 2015, S. 19 u. S. 23.
181Der Grund für die meisten Banden- und Dorfkriege dürfte, grob vereinfacht, in einem gestörten Gleichgewicht zwischen Bevölkerungsgröße und Ressourcen gelegen haben.
182Vgl. Diamond, Jared: The Worst Mistake in the History of the Human Race, a. a. O.
183Vgl. Rademacher, Cay: Als der Mensch zum Bauern wird, S. 67, in: GEO kompakt, Nr. 37, 2013, S. 58–70.
184Vgl. Heinberg, Richard: Jenseits des Scheitelpunkts, a. a. O., S. 75.
185Vgl. Harris, Marvin: Kannibalen und Könige, a. a. O., S. 103–104.
186Vgl. Harari, Yuval Noah: a. a. O., S. 171.
187Ebenda, S. 173.
188Vgl. Harris, Marvin: Kannibalen und Könige, a. a. O., S. 112–113.
189Vgl. Mesenhöller, Mathias: Das Prinzip Macht, S. 143–144, in: GEO kompakt, Nr. 37, 2013, S. 138–146.
190Vgl. Hassett, Brenna: Warum wir sesshaft wurden und uns seither bekriegen, wenn wir nicht gerade an tödlichen Krankheiten sterben, Darmstadt 2018, S. 99.
191Logischerweise waren es die ersten fortschrittlichen Staaten wie das Land Sumer (Süd-Mesopotamien) oder Ägypten, die vor ca. 3.000 v. Chr. die ersten Schriften entwickelten.
192Zitiert nach: Harf, Rainer/Witte, Sebastian: Wem verdanken wir unsere Zivilisation, Herr Professor Parzinger?, S. 26, in: GEO kompakt, Nr. 37, 2013, S. 24–31.
193Vgl. Scheidler, Fabian: Das Ende der Megamaschine, a. a. O., S. 27.
194Vgl. Hassett, Brenna: a. a. O., S. 304.
195Vgl. ebenda, S. 120.
196Vgl. Harari, Yuval Noah: a. a. O., S. 255–256.
197Liebsch, Thomas: Zivilisationskollaps, a. a. O., S. 132.
198Vgl. ebenda, S. 139.
199Vgl. Mauser, Wolfram: Wie lange reicht die Ressource Wasser?, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2007, S. 47–48.
200Vgl. Ländliches Fortbildungsinstitut (Hg.): BIOEE Bildungsoffensive, 2. Kapitel: Energie, Wien, o. J. Online unter: https://www.biomasseverband.at/wp-content/uploads/2_Kapitel_Energie.pdf[Stand: 9.10.2020].
201Vgl. Heinberg, Richard: Jenseits des Scheitelpunkts, a. a. O., S. 34–35.
202Vgl. Mandel, Ernest: Einführung in den Marxismus, 8. Auflage, Karlsruhe 2008, S. 24–25.
203Vgl. Sieferle, Rolf Peter: Lehren aus der Vergangenheit, a. a. O., S. 12–13.
204Vgl. ebenda, S. 13.
205Vgl. ebenda, S. 16.
206Vgl. Scheidler, Fabian: Das Ende der Megamaschine, a. a. O., S. 42.
207Vgl. ebenda, S. 40.
208Vgl. ebenda, S. 35.
209Vgl. ebenda.
210Vgl. Steffen, Will et al.: The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?, a. a. O., S. 615.
211Vgl. Scheidler, Fabian: Das Ende der Megamaschine, a. a. O., S. 132.
212Vgl. Horst, Uwe/Prokasky, Herbert/Tabaczek, Martin: Europäische Agrargesellschaften. Bäuerliches Leben in der römischen Antike und im mittelalterlichen Deutschland, Paderborn 1991, S. 138–148.
213Vgl. ebenda, S. 174–175.
214Hardin, Garrett: The Tragedy of the Commons, in: Science, Nr. 162, 1968, S. 1243–1248.
215Marquardt, Bernd: Gemeineigentum und Einhegungen – Zur Geschichte der Allmende in Mitteleuropa, S. 15, in: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL): Berichte der ANL 26, Laufen 2002, S. 14–23.
216Radkau, Joachim: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt, München 2002, S. 92.
217Vgl. Fersterer, Matthias: Allmende revisited, S. 38, in: Oya – anders denken. anders leben, Heft 1, 2010, S. 34–38.
218Vgl. Bortis, Heinrich: Die Wirtschaft im Mittelalter (500–1500). Text online unter: https://www.unifr.ch/withe/assets/files/Bachelor/Wirtschaftsgeschichte/Die_Wirtschaft_im_Mittelalter_Wige.pdf[Stand: 2.5.2020].
219Vgl. Mandel, Ernest: a. a. O., S. 28.
»Fortschritt ist etwas, das auf dem allgemeinen und angeborenen Verlangen jedes Wesens beruht, über seine Verhältnisse zu leben.«
Samuel Butler, englischer Philosoph, Schriftsteller und Essayist
8. Fortschritt und Naturbeherrschung
Jede Epoche hat einen zumeist nicht reflektierten Hintergrundmythos, der von einer überwältigenden Mehrheit der Menschen in einer Gesellschaft geteilt wird. Unser Mythos ist der Glaube an den Fortschritt.
Dieser Glaube lässt sich wie folgt zusammenfassen: Fortschritt kommt immer durch Technik. Technik ist immer zielgerichtet und alternativlos. Und: Technik ist immer westlich. 220
Der gängigen Fortschrittserzählung liegt die Vorstellung zugrunde, dass sich die Dinge zwangsläufig so entwickeln mussten, wie sie sich schließlich entwickelt haben. Wir als Menschheit entwickeln uns also immer nur in eine Richtung: nach vorne.
Das neuzeitliche Weltbild ist linear. Es gibt immer Fortschritt. Das Bessere ersetzt immer das Schlechtere.
Diese Vorstellung ist falsch. Was besser ist, setzt sich nicht zwangsläufig durch – die menschliche Geschichte ist voll von Beispielen. 221Ob sich etwas durchsetzt, hängt davon ab, ob es zu unserem expansiven Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell passt. Dessen Kern besteht darin, aus Geld mehr Geld zu machen. Und uns von allem mehr zu verschaffen: mehr Naturbeherrschung, mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr Vollkommenheit. Fortschritt ist eine Art Quellcode des Kapitalismus. Wie kommt das?
Читать дальше