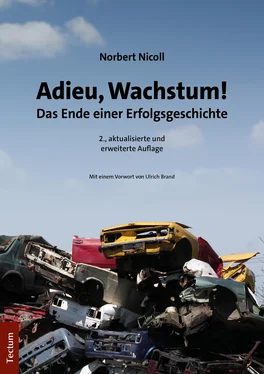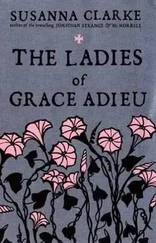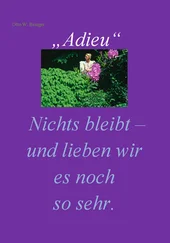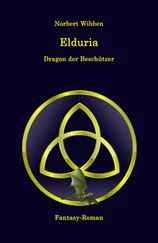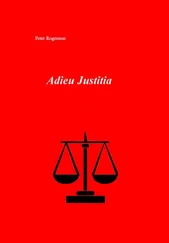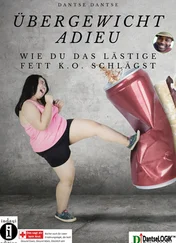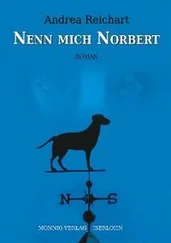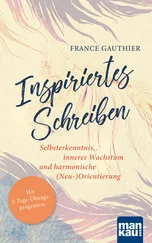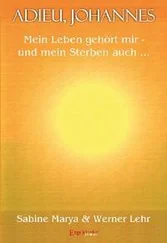Das Problem mit der Allmende ist oberflächlich betrachtet immer das gleiche: Ohne Regeln ist die Weide schnell kahlgefressen, der Wald rasch abgeholzt und der See rasant leergefischt. Jeder versucht das meiste für sich herauszuschlagen. Wer die Probleme kommen sieht und sich zurückhält, wird verlieren. Es finden sich genügend weniger rationale (positiv formuliert) bzw. egoistische (negativ formuliert) Zeitgenossen, die sich nicht zweimal bitten lassen, um einen Vorteil zu gewinnen. Kurzfristige Vorteile für Einzelne werden durch langfristige Nachteile allerdings mehr als aufgewogen.
Doch stimmt das wirklich? Das Problem der Allmende beschrieb der Biologe Garrett Hardin im Jahr 1968 in einem ebenso berühmten wie umstrittenen Aufsatz für die Wissenschaftszeitschrift Science. Titel: The Tragedy of the Commons. 214Hardin sah die Zerstörung der Allmende als zwangsläufig an. Es sei Schicksal gewesen, und nichts habe dagegen getan werden können. Der Text gehört heute zu den Klassikern der Nachhaltigkeitsliteratur. Hardins Text wurde auch jenseits der Biologie und der Ökonomik vielfach rezipiert, aber auch kritisiert: Hardin gehe, so der Vorwurf, von einer fest umrissenen kleinen Gruppe (die Bauern eines Dorfes) aus, die eine Ressource nutze. Gerade auf dieser Ebene funktionierten Nutzungsabkommen und soziale Kontrollmechanismen oft sehr gut. Die jüngere Forschung stützt diese Kritik: Die Nutzungsbedingungen der Allmende wurden genossenschaftlich festgelegt. Über Termine für Aussaat und Ernte befand die Dorfgemeinschaft. Die Quellen aus dem Spätmittelalter zeigen, dass es in vielen Dörfern ein gewisses Bewusstsein für Nachhaltigkeit gab.
Von einer Ungeregeltheit der Allmende kann keine Rede sein. Der Rechtshistoriker Bernd Marquardt meint: »Lokales Gemeinschafts- oder ›Gesamteigentum‹ bedeutete aber gerade nicht, dass sich jeder nehmen konnte, was und wie es ihm beliebte.« 215Marquardt verweist zudem auf ein entscheidendes Wesensmerkmal der Allmendeflächen: Diese seien immer lokal und kleinräumig gewesen. Innerhalb der Gemeinschaft konnten die Dorfbewohner Zusammenhänge überschauen und verstehen – und eine Übernutzung verhindern.
Hinzu kommt: Die dörflichen Gemeinschaften waren nicht-kapitalistisch, es gab keinen Anreiz, irgendwelche Einkünfte zu maximieren. Deshalb schlussfolgert der Umwelthistoriker Joachim Radkau: »Solange sich die Nutzung der Allmende im Rahmen der Subsistenzwirtschaft hielt und von keiner Dynamik der Einkommensmaximierung gepackt wurde, gab es eine gewohnheitsmäßige Selbstbeschränkung.« 216
Mit der fehlenden Dynamik der Einkommensmaximierung war es zuerst in England vorbei. Dort geriet die feudalrechtliche Agrarordnung schon im Spätmittelalter unter Druck – und damit auch das Allmendeland. In Kontinentaleuropa wurde Allmendeland wesentlich später in Privateigentum überführt. Agrarreformen sorgten im 18. und im 19. Jahrhundert für eine Einhegung der Ländereien. Die Feldstrukturen, wie wir sie heute kennen, bildeten sich heraus. 217Die Dreifelderwirtschaft wurde von der Fruchtfolge abgelöst. Und auf die Subsistenzwirtschaft folgte die kapitalistische Produktions- und Lebensweise, um die das übernächste Kapitel kreisen wird.
Als Zwischenfazit lässt sich die folgende Feststellung treffen: Das Problem der Allmende ist ein reales, aber auf das Mittelalter trifft die Problembeschreibung kaum zu. Vielmehr scheint das Problem ein sehr modernes zu sein. In der global vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts gibt es keine wirklich starke Regelungsinstanz, die die Übernutzung der Ressourcen wirkungsvoll verhindern kann. Daran ändern auch internationale Vertragswerke nichts.
Statisches Mittelalter?
Das Mittelalter wird gerne als düster und statisch bezeichnet. Eine Einschätzung, die nur bedingt richtig ist. Zugegeben: Alles lief gemächlicher ab. Tag und Nacht sowie die religiösen Riten und Feiertage gaben maßgeblich den Lebensrhythmus vor. Zeit war subjektiv, die Zeit gab es nicht. Doch dieser Befund gilt auch für die frühe Neuzeit. Die Zeitvereinheitlichung begann erst im 19. Jahrhundert, als die Eisenbahn weit entfernte Regionen miteinander verband und es erforderlich wurde, eine einheitliche Zeit festzulegen.
Die Menschen tickten eindeutig nicht-kapitalistisch. Aus Geld mehr Geld zu machen, war geradezu verpönt. Händler und Kaufleute waren vielen Menschen suspekt. Entgegen der landläufigen Meinung gab es im Mittelalter aber viele technische Fortschritte. In der Landwirtschaft tauchten der schwere Pflug, die Dreifelderwirtschaft, Hufe aus Eisen sowie Anspannvorrichtungen für Wagen auf, was die Produktivität zu steigern half. Im Bereich der Seefahrt tat sich auch einiges. So trugen der Kompass, die Einführung größerer Schiffe und die Kartographie zu einer wesentlich größeren Leistungsfähigkeit bei. Ferner erfolgten große und kleine Revolutionen im Bankwesen wie in der Buchhaltung. Die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wissen konnte sich nun viel schneller verbreiten. Einige Jahrhunderte vorher war das intellektuelle Leben durch die Gründung von Universitäten und Klöstern angeregt worden.
Allerdings blieb das Energieregime im Grundsatz unangetastet. Holz war von zentraler Bedeutung – damit ging die Waldrodung weiter. Die Wasserkraft wurde im Laufe des Mittelalters immer besser genutzt. Die von Wasser angetriebenen Arbeitsmühlen erforderten eine präzise Mechanik. In gewisser Weise führten die Mühlen in West- und Zentraleuropa sogar zu einer Maschinenbau-Tradition, wie der Wirtschaftshistoriker Heinrich Bortis meint. Der amerikanische Wirtschafts- und Kulturhistoriker John Nef spricht sogar von einer mittelalterlichen industriellen Revolution, die die technischen Grundlagen für die spätere »echte« Industrielle Revolution lieferte. 218
Genau wie die antiken Gesellschaften waren auch die mittelalterlichen Gesellschaften agrarisch ausgerichtet. Es gab auch im Mittelalter keinen Mangel an billigen Arbeitskräften. Die Leibeigenschaft sorgte dafür, dass die Lehnsherren einen Großteil der Arbeitskraft ihrer hörigen Bauern beanspruchen konnten. Zugespitzt lässt sich die These aufstellen, dass Arbeitskraft dermaßen billig war, dass sich Maschinen nicht lohnten – wir kommen auf diese These noch zurück.
Solange sich die herrschenden und besitzenden Klassen das gesellschaftliche Mehrprodukt in Form von Gebrauchsgütern aneigneten, bildete ihr eigener Verbrauch enge Grenzen für das Wachstum der Produktion. Und das war eine Konstante seit der Einführung des Ackerbaus: Sowohl die Sklavenhalter der griechisch-römischen Antike als auch die chinesischen, indischen oder arabischen Grundeigentümer wie auch der europäische Feudaladel des Mittelalters – sie alle hatten kein Interesse daran, die Produktion noch weiter zu steigern. Irgendwann hatten sie genug Lebensmittel, Luxusartikel und Kunstgegenstände angehäuft.
Erst als das gesellschaftliche Mehrprodukt die Form des modernen Geldes annahm und es nicht mehr nur um den Erwerb von Verbrauchs-, sondern auch um den Erwerb von Produktionsgütern ging, gewannen die herrschenden Klassen allmählich ein Interesse daran, die Produktion unbegrenzt zu steigern. 219
Bis dato fehlten aber die Anreize zur Rationalisierung. Die Investitionen in den technischen Fortschritt waren aus heutiger Sicht gering. Damit ist das wichtigste Schlagwort des nächsten Kapitels gegeben.
157Vgl. Liebsch, Thomas: Zivilisationskollaps. Warum uns der Zusammenbruch droht und wie wir ihn noch abwenden können, München 2020, S. 156.
158Bis vor kurzer Zeit ging man davon aus, der Homo sapiens sei etwa 200.000 Jahre alt. Doch kürzlich wurden Knochenfragmente in Marokko gefunden, die etwa 100.000 Jahre älter sind.
159Rabhi, Pierre: Manifeste pour la terre et l’humanisme. Pour une insurrection des consciences, Arles 2008, S. 49.
Читать дальше