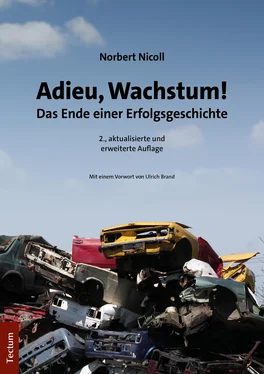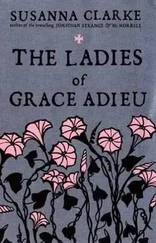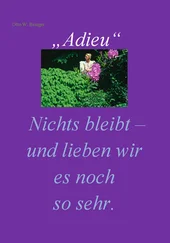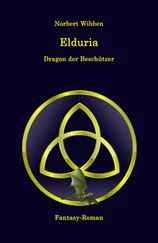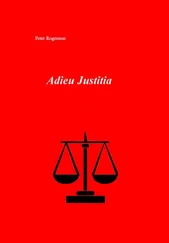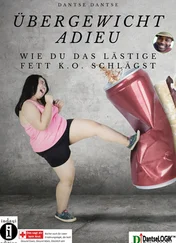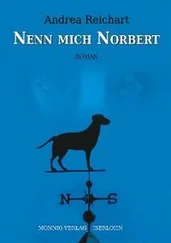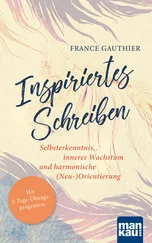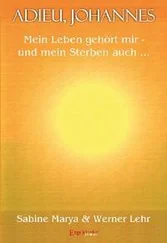Der Ursprung der Fortschrittsidee
Die Idee des Fortschritts hat ihre Wurzeln in der frühen Neuzeit. Zunächst einmal handelt es sich bei der Fortschrittsidee um eine zeitliche Ordnungsvorstellung. Sie hilft uns dabei, Ereignisse in der Gegenwart wie in der Vergangenheit zu verstehen und Aussagen über die Zukunft zu treffen.
Aus einer historischen Perspektive ist der Fortschrittsglaube etwas relativ Neues. Wir müssen damit noch einmal zurück in die Antike und ins Mittelalter …
In der Antike dachte man anders als heute. Im Denken Platons kam der Gedanke des Niedergangs ständig vor. Er glaubte, dass alles, sowohl die Natur als auch die Gesellschaft, dem Verfall ausgeliefert sei. Platon und viele andere Denker und Gelehrte der Antike wie Homer oder Cicero zogen Parallelen zum Lebensverlauf: Auf die Geburt folgt Wachstum, auf Wachstum folgt das Altern, auf das Altern folgt der Tod. Im Rom der Kaiserzeit glaubte man an das zyklische Auf und Ab. Höhen und Tiefen des Reiches wechselten sich nach dieser Auffassung in der römischen Geschichte ebenso ab wie gute und schlechte Herrscher.
In der Antike waren also zyklische Geschichtsauffassungen weit verbreitet. Demnach kehrte das Gleiche periodisch wieder. Geschichte konnte sich also wiederholen. Aus der Warte der Fortschrittsidee wiederholt sich Geschichte nicht. Die Vergangenheit ist abgeschlossen – sie kommt niemals zurück.
Im europäischen Mittelalter war ein statisches Geschichtsbild dominant. Die Menschen waren stark auf das Jenseits ausgerichtet. Der christlichen Religion kam eine überragende Bedeutung zu. Ora et labora, zu beten und zu arbeiten, das waren die Gebote der Zeit. Einfach und arm wurde im Diesseits gelebt – damit war die Hoffnung verbunden, im Jenseits belohnt zu werden. 222
Wer glaubt, dass die Geschichte auf der Stelle tritt, glaubt gleichzeitig auch, dass die Gesamtsumme des Wohlstands begrenzt ist. Dass die Wirtschaft wachsen und dass damit der wirtschaftliche Kuchen größer werden könnte, kam den Zeitgenossen nicht in den Sinn. Die Wirtschaft wurde als Nullsummenspiel aufgefasst. Die Handels- und Seefahrermetropole Venedig konnte zwar einen Boom erleben, aber nur dann, wenn es der Konkurrenz aus Genua schlechter ging. Und der König aus Frankreich konnte zwar reicher werden – aber nur auf Kosten des englischen Königs. 223
Wissen wurde anders aufgefasst als heutzutage. Die Vertreter des Christentums hatten immer wieder erklärt, dass alles, was es zu wissen gab, schon bekannt war. Die Religionsvertreter gaben vor, im Besitz aller Antworten zu sein. Wissenserwerb bedeutete, die alten Weisheiten in alten Schriften oder mündlichen Überlieferungen gründlich zu studieren, kurz einen vorhandenen Kanon zu erlernen und nachzubeten. Es war nicht vorstellbar, dass die Bibel entscheidende Geheimnisse des Universums übersehen haben könnte. 224
Der Ort des guten Lebens verlagert sich ins Diesseits
Die (frühe) Neuzeit änderte alle diese Auffassungen. Mit der Aufklärung im 17. und im 18. Jahrhundert verlagerte sich der religiöse Gedanke der Erlösung in das Diesseits. Nicht durch die Gnade eines Gottes, sondern durch Verstand und Tatkraft der Menschen sollten die vorgefundenen Verhältnisse verändert und verbessert werden. In der Konsequenz wurde eine Höherentwicklung der irdischen Verhältnisse angestrebt. 225
Die Idee der Aufklärung ist auf das Engste mit der Lichtmetaphorik verbunden. Dem »finsteren Mittelalter« wurde ein »helleres Zeitalter« gegenübergestellt. Die Aufklärer erhoben die Vernunft zu ihrer Kernidee. Die Vernunft ist im aufklärerischen Denken das Prinzip, das der Wirklichkeit Sinn, Struktur und Ordnung verleiht. Der Gebrauch der Vernunft ermöglicht die Befreiung von Kräften, Mächten und Lehren, die den Menschen unterdrücken und in Abhängigkeit halten. 226
So war es nur konsequent, dass vormoderne Wissenstraditionen abgelöst wurden. Die Menschen erkannten, dass das alte Wissen unzureichend war. Die alten Wälzer aus dem Kirchenbestand wurden zur Seite gelegt. Man gestand sich ein, dass man nicht viel wusste. Und legte den Schwerpunkt auf Beobachtungen und Experimente.
Es wurden enorme Ressourcen in die naturwissenschaftliche Forschung investiert. Das war die Grundlage für eine wissenschaftliche Revolution. 227Diese brachte die europäischen Gesellschaften voran. Die Geschichte bewegte sich fortan vorwärts. So konnte sich die Fortschrittsidee etablieren.
Kredit und das Ende des Nullsummenspiels
Die Idee, die Menschheit schreite in eine bessere Zukunft fort, kommt in Europa im 16. Jahrhundert auf. Am Anfang wird der Begriff wissenschaftlich-technisch verstanden. Im 18. Jahrhundert entsteht in Frankreich der Begriff »progrès«, der im Deutschen etwa um das Jahr 1800 zum »Fortschritt« wird. Er ist anfänglich stark verbunden mit dem Liberalismus. Im Unterschied zu Konservativen halten Liberale die Welt nicht für gott- bzw. naturgegeben, sondern für veränderbar. 228
Das aufkeimende Fortschrittsdenken im 18. Jahrhundert und die Begeisterung für die Naturwissenschaften hatten vielfältige Folgen.
Unter dem Eindruck des sich verbreitenden Fortschrittsgedankens wuchs das Vertrauen in die Zukunft. Wer an Fortschritt glaubt, ist überzeugt, dass sich die Produktion, der Handel und der Wohlstand steigern lassen. Die Wirtschaft wurde nicht länger als Nullsummenspiel begriffen. Die Handelsrouten im Atlantik ließen sich aufbauen, ohne die alten Routen im Indischen Ozean abzuwerten.
Diese veränderte Haltung hatte diverse Konsequenzen. Eine war der Siegeszug des Kredits. Das Instrument des Kredits hatte es vorher auch schon gegeben, aber es fehlte das Vertrauen in die Zukunft. Jetzt war es da, und dieses Vertrauen sollte Kredite bereitstellen und Wirtschaftswachstum generieren. Das Wirtschaftswachstum wiederum stärkte das Vertrauen in die Zukunft und bereitete den Boden für neue Kredite. 229Billiges Geld ermöglichte billige Nahrung, billige Arbeit, billige Energie und billige Ressourcen – Schmiermittel eines entstehenden Wirtschaftssystems, des Kapitalismus (um ihn wird sich das nächste Kapitel drehen). Möglich wurden durch das billige Geld auch neue Grenzziehungen durch koloniale Unternehmungen, die den Lauf der Geschichte veränderten.
Das mechanistische Weltbild
Die »europäische Rationalität der Weltbeherrschung« (Max Weber) hatte Folgen für das Verhältnis zur Natur. Francis Bacon war der Erste, der ausführlich den Gedanken äußerte, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt in der Naturbeherrschung der Garant dafür sei, dass gesellschaftlich-sozialer Fortschritt möglich werde. 230Andere folgten. René Descartes, Isaac Newton, John Locke und Adam Smith brachten die Idee des mechanistischen Weltbildes nach vorne.
Der Glaubenssatz, dass wir Menschen isolierte Individuen seien, lässt sich auf diese Denkweise zurückverfolgen. Demzufolge sind wir zunächst eines: separate Wesen, eingeschlossen in unsere Körper. Der Rest ist »außen«. Das große Ganze ergibt sich nur aus der mechanistischen Verbindung vieler Teile. Daraus konnte sich Vertrauen in Märkte ergeben. Im Markt ist, so die Vorstellung, alles wie eine Maschine arrangiert, so dass am Ende, wenn jeder ganz egoistisch sein eigenes Interesse verfolgt, es früher oder später allen nutzt. 231
Jenes mechanistische Weltbild propagiert Wissenschaft und Technologie, um Fortschritt zu erlangen. Es stellt die Machbarkeit der Dinge in den Mittelpunkt. 232Natur an sich ist in diesem Weltbild erst einmal wertlos. Typisch ist die Vorstellung von John Locke, demzufolge alles in der Natur als wertlos angesehen wird, bis es menschliche Arbeit in etwas Wertvolles verwandelt hat. 233John Locke meinte gar: »Die Negation der Natur (sei) der Weg zum Glück«.
Die Natur erschien den Vordenkern eines mechanistischen Weltbildes zudem als unzerstörbar, unerschöpflich und grenzenlos belastbar. Sie gingen von einer Art »Naturkonstanz« aus. Die Vorstellung, dass menschliches Wirken eines Tages planetare ökologische Grenzen sprengen könne, lag außerhalb der Vorstellungskraft der tonangebenden Philosophen. 234
Читать дальше