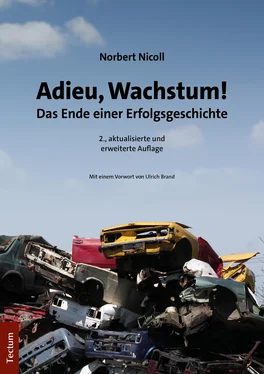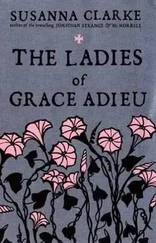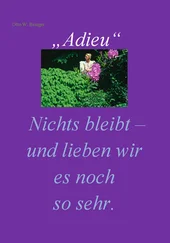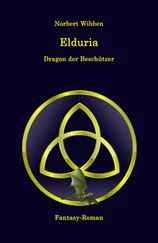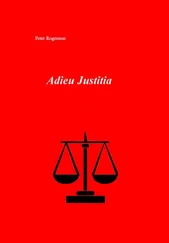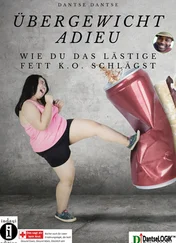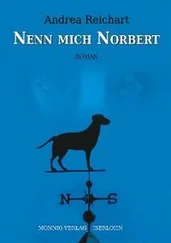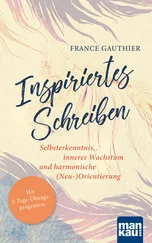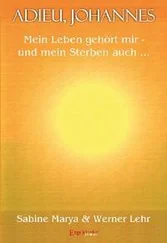Der Programmierung in unseren Köpfen sind wir allerdings nicht willen- und schutzlos ausgeliefert. Dem Menschen ist es möglich, sich künftiger Bedürfnisse bewusst zu werden und Vorsorge zu treffen. In der Steinzeit wie auch heute versuchen Menschen, Vorsorge für den Fall von Hunger, Durst oder Krankheiten zu treffen. Was den Umgang mit der ökologischen Krise und eine entsprechende Vorsorge erschwert, ist der Zeithorizont. Die Zukunft scheint noch sehr weit weg zu sein. Was wird im Jahr 2040 sein? Was 2050? Und was 2100? Gefühlt sind das Ewigkeiten.
Die Gegenwart zählt für unser Gehirn viel stärker als eine weit entfernte Zukunft. Je weiter ein Vorteil in der Zukunft entfernt ist, umso weniger wert ist er für unser Gehirn. Dieses Phänomen ist in der Psychologie als zeitliche Diskontierung bekannt. 141
Shifting Baselines
Menschen wie Tiere reagieren durchaus auf eindeutige und klar wahrnehmbare Gefahren. Da die globale Mitteltemperatur und der Meeresspiegel aber nur sehr langsam steigen, fehlt der Erfahrungs- bzw. Wahrnehmungsbezug. Ein Leidensdruck ist damit ebenso wenig vorhanden wie ein Schmerz- oder Mangelgefühl.
Eng mit diesem Themenkomplex verbunden ist ein Konzept aus der Umweltforschung. Es nennt sich Shifting Baselines. Mit diesem Begriff wird ein Phänomen beschrieben, wonach sich die Orientierungspunkte, anhand derer die Menschen ihre Umwelt beurteilen, schleichend und unbemerkt verschieben. 142Menschen halten immer jenen Zustand ihrer Umwelt für den »natürlichen«, der mit ihrem Lebens- und Erfahrungshorizont zusammenfällt. Und Menschen verändern sich mit ihrer Umwelt in ihren Wahrnehmungen und Werten gleitend, ohne dass sie dies selber bemerken. 143Shifting Baselines sind insofern auch dafür verantwortlich, was wir für normal halten und was nicht.
Im Zusammenhang mit Shifting Baselines – mit unmerklichen schleichenden Veränderungen unserer Wahrnehmung also – wird zur Veranschaulichung immer wieder eine Studie aus dem Jahr 2005 zitiert. 144Diese untersuchte die Wahrnehmung von Fischbeständen an der kalifornischen Küste. Forscher befragten hier drei Generationen von kalifornischen Fischern, wie sich der Fischbestand in ihrer Bucht ihrer Meinung nach verändert hatte. Allen war bewusst, dass sich der Fischreichtum verschlechtert habe. Während die ältesten Fischer sich noch an elf Arten erinnerten, die sie früher vor der Küste fingen und die verschwunden waren, nannten die jüngsten Fischer nur zwei Fischarten, die es früher einmal gab und jetzt nicht mehr. Ihre Wahrnehmung von Umweltveränderungen setzte an einem ganz anderen Referenzpunkt an, sie nahmen nur die Verschlechterung der Fischbestände von ihren verschobenen Referenzpunkten aus wahr. Das Fehlen der Fischarten gegenüber dem früheren Zustand in unmittelbarer Küstennähe war ihnen gar nicht mehr bewusst.
Das Beispiel belegt, wie schwer der Umgang mit langfristigen Umweltproblemen wird, wenn sich die Referenzpunkte zu ihrer Bewertung kontinuierlich verschieben. 145Das Konzept kann unter dem Strich erklären, warum Menschen ökologische Veränderungen nicht oder nur unzureichend registrieren.
Und dann gibt es noch ein Problem. Die Menschen in den Industrieländern haben in der Vergangenheit allzu häufig die Erfahrung gemacht, dass viele Schreckensmeldungen nicht eintreten. Krisen- und Katastrophenmeldungen gibt es in den Medien häufig – oft genug erweisen sich diese jedoch als Sturm im Wasserglas. Die »Schweinegrippe« ist ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Manche werden sich auch an den Hype um den globalen Computerabsturz im Zuge des Jahrtausendwechsels erinnern (Stichwort: Millenium-Bug). Der befürchtete Mega-Absturz kam nie.
Angesichts dieser und anderer Beispiele ist es nicht verwunderlich, dass sich bei vielen Menschen ein Denkreflex auf Schreckensmeldungen herausbildet: »Es wird schon nicht so schlimm kommen.« Erst in Krisen beginnen die Menschen zu handeln. Das hat das Ozonloch gezeigt. Oder die Kuba-Krise, die erst zur Rüstungskontrolle und dann zur atomaren Abrüstung führte.
Das Problem ist nur: Wir haben keine Zeit. Veränderungen in der Sphäre der Umwelt vollziehen sich nur sehr langsam und machen sich oft erst nach Jahrzehnten bemerkbar. Abzuwarten, bis die schlimmsten Konsequenzen der ökologischen Krise eingetreten sind, ist keine Option. Und dennoch wählen die (nicht-)handelnden Politiker genau diesen Weg des Abwartens. Gründe dafür gibt es viele. Der vielleicht wichtigste ist der Einfluss der Lobbyisten der alten Industrien auf die politischen Entscheidungsträger. Die politischen Systeme der »westlichen Demokratien« sind vom ganz großen Geld durchsetzt.
Früher galt einmal: one person, one vote. Vorbei. Heute gilt: one Dollar, one vote. Oder: one Euro, one vote. Der US-amerikanische Investigativjournalist Greg Palast schrieb vor einigen Jahren ein Buch zu diesem Problemkomplex. Der Titel des Schmökers ist äußerst treffend: The Best Democracy Money Can Buy. 146
Vor allem die Auto-, Energie- und Ölindustrie nehmen beträchtliche Summen in die Hand, um selbst kleine Fortschritte im Keim zu ersticken. So gab der berüchtigte Ölkonzern ExxonMobil in der Vergangenheit mehr Geld für Lobbyarbeit in Washington aus als alle Hersteller von Solarzellen und Windrädern zusammengenommen. 147Zusammen mit Chevron, Royal Dutch Shell und anderen Akteuren aus dem Öl-Business finanziert ExxonMobil in den USA Lobbygruppen, marktradikale Think Tanks 148und klimaskeptische Gruppen. Mit Summen, an die weder Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien noch Umweltschutzgruppen auch nur annähernd heranreichen. 149
Die Lobbyarbeit der Unternehmen zielt natürlich auch auf die Bürger und den schon beschriebenen Mechanismus der Dissonanzreduktion. Beim Bürger soll sich die Überzeugung einstellen: »Die einen Wissenschaftler sagen das, die anderen behaupten das Gegenteil. Warten wir ab, bis sie sich geeinigt haben.« Gerade in den USA sind die Erfolge der Lobbyarbeit spektakulär: Im Jahr 2007 glaubten einer Harris-Umfrage zufolge 71 Prozent der US-Amerikaner, dass der Einsatz fossiler Brennstoffe das Klima erwärme. Im Jahr 2009 waren nur noch 51 Prozent der Menschen dieser Ansicht, und im Jahr 2011 teilten nur noch 44 Prozent der Bevölkerung diese Auffassung. 150In Europa sieht das Meinungsbild glücklicherweise noch anders aus.
Für die politischen Entscheidungsträger, für die Merkels, Macrons und Bidens, ergibt sich das Problem, dass die Kosten, jetzt etwas zu tun, aus persönlicher Sicht höher sind, als nichts zu tun. In ein paar Jahren sind sie nicht mehr im Amt. Sie schreiben dann ihre Memoiren – oder arbeiten vielleicht selbst als Lobbyisten.
Kulturelle Scheuklappen
Kulturelle Einflussfaktoren sind extrem wichtig. Unsere Kultur prägt unsere Wahrnehmung der Welt sowie unsere Wahrnehmung von Risiken. Unsere Kultur bestimmt, was »normal« und »angemessen« ist. Kultur ist, so formulierte es einst Terrence McKenna, für den Menschen das, was ein Betriebssystem für den Computer ist. 151Wir leben in einer kapitalistischen Kultur. Wir haben kapitalistische Verhaltensmuster erlernt und verinnerlicht. Folglich sind wir alle auf Gelderwerb und Geldvermehrung fokussiert.
Der Geograph Jared Diamond hat sich in seiner äußerst gründlichen Studie Kollaps u. a. mit dem Niedergang der Osterinsel befasst. 152Er fragt: »Was sagte der Bewohner der Osterinsel, der gerade dabei war, die letzte Palme zu fällen?« 153Die Antwort liefert Diamond fast 400 Seiten später, 154aus der Sicht eines Bewohners der Osterinsel lautet sie wie folgt: »Weil Bäume aus religiösen Gründen schon immer gefällt wurden und es als völlig normal empfunden wurde, dass auch der letzte fällt.«
Menschen sind – und das wurde nun schon mehrfach erwähnt – Gruppenwesen. Und die Gruppe, in der sie leben, prägt ihre Sicht der Welt. Wir wachsen mit vielen nützlichen Dingen auf und halten sie für das Normalste der Welt. Dass diese Dinge uns eines Tages nicht mehr zur Verfügung stehen könnten, kommt uns nicht in den Sinn. Es ist die kulturelle Lebensform selbst, die manchmal ausschließt, dass bestimmte Sachverhalte gesehen oder schädliche Gewohnheiten geändert werden können. Aus der Außenperspektive erscheint völlig widersinnig, was aus der Binnensicht große Rationalität besitzt. 155Um bei dem Beispiel der Osterinsel zu bleiben: Die soziale Katastrophe der Osterinsel beginnt nicht mit dem Fällen des letzten Baumes, sondern deutlich vorher, nämlich mit dem Fällen des ersten Baumes. Für die Insulaner war freilich das Ende nicht absehbar.
Читать дальше