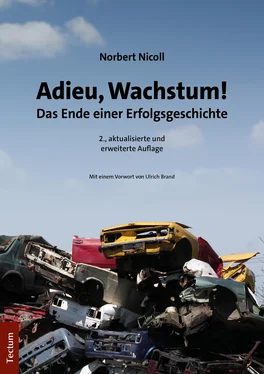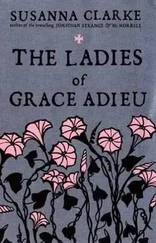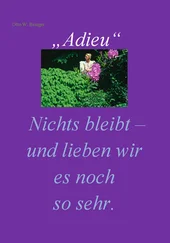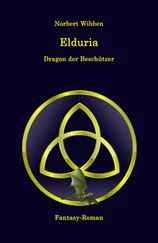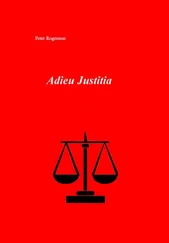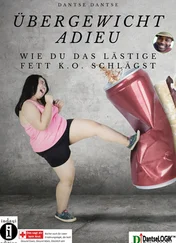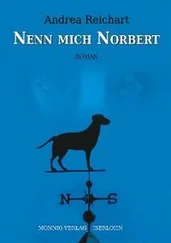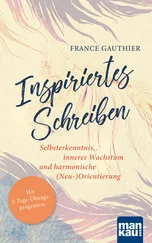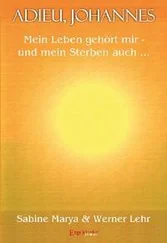116Zitiert nach: Panaroma, ARD-Magazin, Sendung vom 6.8.2009, 21.45–22.15 Uhr.
DENKWEISEN
»Wenn wir den Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation verhindern wollen, brauchen wir nichts Geringeres als eine Umwälzung der herrschenden kulturellen Muster.«
Erik Assadourian, Nachhaltigkeitsforscher, Worldwatch Institute
6. Die Software in unseren Köpfen
Der im Mai 2010 in die Kinos gekommene Dokumentarfilm The Age of Stupid 117war kein Kassenschlager. Der Film verfolgt jedoch einen interessanten Ansatz. Die Dokufiktion blickt aus der Perspektive des Jahres 2055 zurück auf das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Die Lebensgrundlagen im Jahr 2055 sind zerstört, und die Menschheit ist ausgestorben. Der Film fragt: Warum haben die Menschen nichts getan? War das frühe 21. Jahrhundert das Zeitalter der Dummheit?
Das Zeitalter der Dummheit. Werden so unsere Kinder und Kindeskinder mal über uns urteilen? Warum tun wir also nichts? Welches Sedativum haben wir genommen?
Keins, sagen viele. Und verweisen auf einen harten Fakt: Der Tag hat nun einmal nur 24 Stunden. Und in dieser Zeitspanne kann man nur einer begrenzten Zahl von Aktivitäten nachgehen. Neben der Alltagsorganisation plagen viele Menschen Probleme mit der Gesundheit, Ängste um den Arbeitsplatz oder finanzielle Engpässe. Außerdem muss Zeit aufgewendet werden für die Pflege der Partnerschaft und für das Wohl der Kinder. Zusätzlich locken attraktive Freizeitangebote.
Und einer Arbeit nachgehen muss man natürlich auch. In vielen Berufen steigen die Belastungen, gefordert ist der flexible Mensch. 118Stress, Eile und Zeitnot greifen um sich. Da bleibt nicht viel Zeit für Reflexion, um über das Schicksal der Erde nachzudenken.
Stets die Weltreichweite vergrößern
Eine andere Antwort jenseits von zeitökonomischen Überlegungen lautet schlicht: Menschen im reichen Europa wollen nicht auf ihr derzeitiges Leben verzichten, weil sie dieses als attraktiv empfinden. Und attraktiv ist dieses Leben, weil es ihnen »dionysische« Gefühlszustände ermöglicht: Begeisterung, Entgrenzung, Rausch, Übermacht, Ekstase. Mit anderen Worten, die nicht-nachhaltige Lebensweise ist »leider geil«, um es mit den Worten einer bekannten deutschen Musikgruppe auszudrücken. Und diese Attraktivität wird nur selten dadurch gemildert, dass sie unter moralischen oder politischen Gesichtspunkten fragwürdig geworden ist. 119
Der im wohlhabenden Westen lebende Homo consumens möchte nicht auf industrielle Bequemlichkeiten wie das Auto, das Flugzeug oder das Smartphone verzichten. Daher handelt er nach der Devise »Nach mir die Sintflut«. Motto: »Hauptsache, ich habe noch schöne Erlebnisse.«
Der Befund ist hart, aber sicher teilweise zutreffend. Jeder Mensch ist ein Stück weit Egoist – das gilt auch für die größten Altruisten. Es mag stimmen, dass viele Menschen in den reichen Ländern von einer Versäumnisangst getrieben werden, sie möchten sich von dem (vermeintlich) überwältigenden Angebot der Multioptionsgesellschaft 120so wenig wie möglich durch die Lappen gehen lassen.
Der kategorische Imperativ der Moderne lautet nämlich: »Handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird.« Dies erfolgt durch die Vermehrung von Gütern, Kontakten und Optionen. Wenn der Mensch vor einer Entscheidung steht, dann wählt er im Regelfall die größere Verfügbarkeit der Welt. Warum ist ein Smartphone interessant? Weil ich meine Weltreichweite vergrößere, denn ich habe alle meine Freunde und die Kontakte zu ihnen in der Hosentasche und bin selbst erreichbar für alle. Ich kann alle Musik der Welt hören, bringe sie in meine Reichweite. 121
Dennoch ist diese zweite These wie auch die erste in vielerlei Hinsicht unbefriedigend. Die Antwort auf die Frage danach, warum wir passiv sind und uns an die Zuschauerrolle gewöhnt haben, ist schwieriger, als es auf den ersten Blick erscheint.
Wissen allein verändert nichts
Fehlt es vielleicht an Wissen, wie manche meinen? Müsste man die Bevölkerung nur ausreichend informieren, damit sich Veränderungen ergeben?
Wissen und Information – beide Begriffe gilt es zu trennen. Eine Information kann alles Mögliche sein, zum Beispiel die Nachricht, dass Angela Merkel Urlaub in der Toskana macht, dass Bayern München gegen Werder Bremen gewonnen hat oder dass Britney Spears unten ohne gesichtet wurde. Das sind Nachrichten ohne Belang. Es ist Informationsmüll. Eine Nachricht ist aber ebenso, dass sich das Artensterben beschleunigt oder dass der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu einem Meter steigen könnte.
Die Menschen haben das Problem der kontinuierlichen, schnellen und variantenreichen Informationsübermittlung gelöst, aber sie wissen nicht, wie sie mit der enormen Menge an Informationen, die sie tagtäglich erreicht, umgehen sollen. 122Wissen ist organisierte Information, genauer eine in einen Kontext eingebettete Information; eine Information, die einen Zweck hat und die einen dazu bringt, sich weitere Informationen zu verschaffen, um etwas zu verstehen. Ohne organisierte Information mögen wir etwas von der Welt wissen, aber nichts über sie. Wer über Wissen verfügt, weiß, wie er Informationen einzuschätzen hat, weiß, wie er sie in Beziehung zu seinem Leben bringt. Vor allem weiß er aber, welche Informationen ohne Bedeutung sind. 123
Die Medien überhäufen uns mit Informationen, stellen aber kaum Zusammenhänge her. Sie präsentieren uns eine Welt, die voll ist mit Unds. Dies geschah und dann das und dann etwas anderes. Es fehlt die Einbettung, es fehlt das Weil. 124Eine erste wesentliche Handlungsschranke ist also Nichtwissen. Wissen muss man sich häufig mühevoll aneignen, es fällt nicht vom Himmel. Ist diese erste Schranke überwunden, gibt es weitere. Oder anders formuliert: Wissen ist eine notwendige, aber allein nicht ausreichende Bedingung für Handlungen und Verhaltensänderungen.
»Nicht die Fakten sind entscheidend, sondern die Vorstellung, die sich die Menschen von den Fakten machen«, sagte einst die Publizistin Marion Gräfin von Dönhoff. Damit hat die ehemalige Grande Dame der deutschen Publizistik zweifellos recht. Es gibt viele Menschen in den Industrieländern (wir alle kennen welche – und wir kennen uns auch selber), die wissen, dass ihr Lebenswandel der Natur Schaden zufügt, die aber dennoch systemtreu bleiben. Zwischen dem Wissen und dem Handeln besteht oft ein immenser Graben (in der Forschung spricht man vom »Mind-Behavior-Gap«). Dieser Graben ist auf zahlreiche intervenierende Faktoren zurückzuführen. Der Mensch ist komplex – er ist nicht vergleichbar mit dem Pawlow’schen Hund, bei dem ein Reiz sofort einen Reflex auslöst. 125
Wenn eine tierische Metapher hilft, dann diese: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das sich kulturell und biologisch in eingefahrenen Bahnen bewegt. Evolutionstheoretisch betrachtet ist der Mensch immer auf die Gegenwart ausgerichtet. Die Gattung Homo sapiens hat sich vor 300.000 Jahren in Afrika entwickelt. Sie hat nur überlebt, indem sie sich immer auf das unmittelbar Bevorstehende konzentriert hat. Mit dem Leben kam davon, wer sich auf den herannahenden Säbelzahntiger fokussiert hat und schleunigst verschwunden ist – und nicht, wer darüber gegrübelt hat, wie die Wolken am Himmel in zehn Jahren aussehen mögen.
Psychologische Studien der letzten Jahre zeigen zudem, dass der Mensch Veränderungen in der Zukunft unterschätzt – und zwar systematisch. Eine großangelegte Studie der Harvard University, an der 19.000 Personen im Alter von 18 bis 63 Jahren teilnahmen, belegt dies eindrucksvoll. 126Viele Menschen glauben, dass der Rhythmus der persönlichen Veränderungen genau heute angehalten wird. Die Probanden der Studie erkannten zwar die Veränderungen in den letzten Lebensjahren und Lebensjahrzehnten, aber die Mehrheit der Befragten war der Ansicht, dass die Zukunft deutlich weniger Veränderungen mit sich bringen werde. Die Zukunft wurde von ihnen als etwas Stabiles begriffen. Motto: »Bis heute hat sich sehr viel verändert – aber ab jetzt gilt das nicht mehr.«
Читать дальше