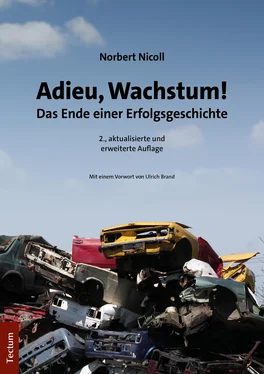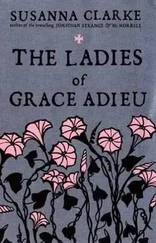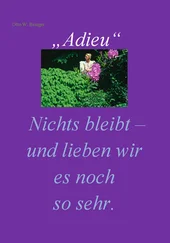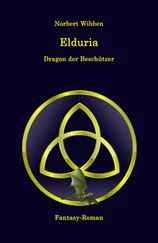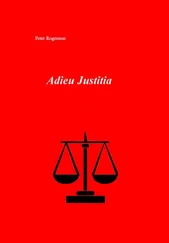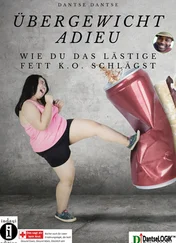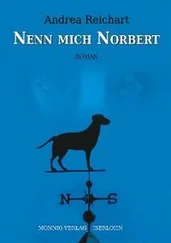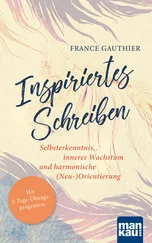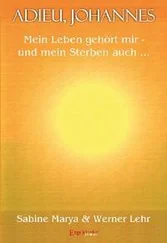Der in Paris geschlossene Vertrag gilt erst seit dem 1. Januar 2020. Papier ist geduldig. Schnelle und drastische Emissionskürzungen sind durch das Vertragswerk erst einmal nicht zwingend vorgeschrieben. James Hansen, einer der weltweit prominentesten Klimatologen, senkte beispielsweise deutlich den Daumen. Leere Worte und Versprechungen habe es in Paris gegeben – und keine ehrgeizigen, konkreten, verbindlichen Reduktionsziele. Hansens Kurzfazit: »Der Vertrag ist wertlos.« 112
Nachhaltigkeit für die Sonntagsreden
Dass der Klimaschutz auf der Stelle tritt, hat viel mit dem mangelnden Ehrgeiz der Industrieländer zu tun. Der Grund für diesen mangelnden Ehrgeiz ist einfach. Bei Lichte betrachtet, ist der westliche Lebensstil vor allem eines: eine »imperiale Lebensweise« (Ulrich Brand). Unser Leben und unser Handeln (v. a. unser politisches!) sind darauf gerichtet, dass die Ressourcenflüsse in die Metropolen des Westens gesichert bleiben. 113In der Umweltpolitik gibt es einen Konsens, dass die bestehenden Verhältnisse nicht angetastet werden dürfen. Kleinere kosmetische Korrekturen werden akzeptiert, aber an den großen Stellschrauben darf nicht gedreht werden. Diese Realität steht in einem krassen Gegensatz zu dem, was die Wissenschaft sagt und was in vielen Reden seit mehr als 30 Jahren verkündet wird. Nachhaltigkeit gilt als das Leitbild jeder Entwicklung. Im Alltagsverstand der meisten Menschen wird der Begriff so verstanden, dass wir nicht auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder leben sollen.
Die UN setzte in den 1980er Jahren die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung ein. Diese Kommission unter dem Vorsitz der Norwegerin Gro Harlem Brundtland prägte das bis zum heutigen Tag dominante Verständnis von Nachhaltigkeit: »Dauerhafte (nachhaltige) Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.« 114
Nachhaltigkeit bedeutet somit vor allem: Künftige Generationen können ihren eigenen Lebensstil wählen und damit selbstbestimmt leben. Damit die Nutzung erneuerbarer Ressourcen nachhaltig ist, dürfen diese nur in einer Menge verbraucht werden, die kleiner oder gleich groß wie ihre natürliche Neubildungsrate ist. Man denke an einen Wald, der abgeholzt wird. Werden über eine lange Zeit mehr Bäume abgeholzt als angepflanzt, hat sich der Wald irgendwann erledigt. Das versteht jedes Kind.
Schwieriger verhält es sich mit nicht erneuerbaren Ressourcen. Damit die Nutzung einer nicht erneuerbaren Ressource nachhaltig ist, muss sie sich mit einer Rate vollziehen, die abnimmt, und diese Abnahmerate muss größer oder gleich groß wie die Erschöpfungsrate sein. Die Erschöpfungsrate ist die Menge, die in Prozent der noch abbaubaren Gesamtmenge in einem bestimmten Zeitraum abgebaut bzw. verbraucht werden kann. Als Zeitraum wird in der Regel ein Jahr angesetzt. Wird diese Regel umgesetzt, so reduziert sich die Abhängigkeit von einem Rohstoff bis zur Unerheblichkeit, bevor dieser Rohstoff erschöpft ist. 115
Nachhaltig ist ein Zustand, der langfristig aufrechterhalten werden kann. Dazu bedarf es des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung. Aber es geht um mehr als »nur« um das – es geht auch um Gerechtigkeit. Die Zukunft muss für die Nachgeborenen offen bleiben. Menschen, die in 50, 100, 200 oder 1.000 Jahren leben, sollen die gleichen Lebenschancen haben wie wir. Doch danach sieht es nicht aus.
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist zu einem Synonym für Systemerhalt verkommen. Die gesamtgesellschaftliche Kurzsichtigkeit ist bemerkenswert ausgeprägt. Man stelle sich vor: Wie würden wir die alten Römer heute beurteilen, wenn sie aus »Wettbewerbsgründen« oder schlichter »Wohlstandsmehrung« ihr Badewasser mit Atomstrom gewärmt hätten und wir nun ihren radioaktiven Müll zu behüten hätten?
Der Ernst der Lage wird von den politischen Führern der größten Volkswirtschaften offenbar immer noch verkannt. Gleiches gilt für die Bevölkerungen der meisten Länder der Erde. Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, einer der bekanntesten Klimawissenschaftler im deutschsprachigen Raum, greift vor diesem Hintergrund zu deutlichen Worten: »Die Fakten sind so klar, dass man sich eigentlich nicht mehr verstecken kann.« Schellnhuber spricht vor dem Hintergrund mangelnder politischer Entscheidungen, aber auch mangelnder individueller Verhaltensänderungen, vom »kollektiven Selbstbetrug einer Gesellschaft, die auf der Titanic tanzt«. 116
Jener von Schellnhuber angedeutete kollektive Selbstbetrug verdient neben aller Kritik ein erhebliches Maß an Verständnis. Die moderne Psychologie ist in der Lage, den Selbstbetrug weitgehend zu erklären. Sozialpsychologen wissen, dass zwischen dem, was Menschen wissen, und dem, was sie tun, mitunter ein sehr großer Graben liegt. Davon handelt das nächste Kapitel.
101Blühdorn, Ingolfur/Deflorian, Michael et al.: Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit: Warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet, Bielefeld 2019.
102Vgl. Barclays Bank (Hg.): Oil in 3D: the demand outlook to 2050, London 2019, S. 14.
103Vgl. Bukold, Steffen/Feddern, Jörg: Öl. Report 2016, Greenpeace Deutschland, Hamburg 2016. Online unter: http://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/oel-report-2016-greenpeace-20160108_0.pdf[Stand: 2.5.2020].
104Damit ist nicht gesagt, dass alle Klagen gegen Windkraftanlagen an den Haaren herbeigezogen sind. Es gibt sehr wohl Probleme mit Windrädern, wenn die Entfernungen zu Wohngebieten nicht groß genug sind. In diesen Fällen muss mit erheblichen Geräuschbelästigungen und Schattenwurf (»Diskoeffekte«) gerechnet werden, die das Leben der Anwohner beeinträchtigen.
105Den gesamten Ansatz, dass man für einen entgangenen Profit entschädigt wird, kann man natürlich fragwürdig finden. Die Frage der Inwertsetzung von Natur wird in Kapitel 14 noch behandelt und kritisiert werden.
106Vgl. Chimienti, Adam/Matthes, Sebastian: Verrat am Regenwald, S. 1, in: Le Monde diplomatique, Oktober 2013, S. 1 u. S. 8 (Fortsetzung des Artikels auf S. 1).
107Vgl. Henkel, Knut: Ecuador fördert nun doch Öl im Regenwald, in: Neues Deutschland vom 17.8.2013, S. 9.
108Gemeint sind hier die sogenannten Annex-I-Staaten. Das sind ausschließlich Industrieländer.
109Eine Klimasimulation des französischen Shift-Instituts geht davon aus, dass im Jahr 2025 6 Prozent mehr Treibhausgase ausgestoßen werden als im Jahr 2015 – trotz des Paris-Abkommens. Folge: Die globale Durchschnittstemperatur steige bis 2100 um mehr als 3 Grad Celsius an. Vgl. dazu Lachaize, Pierre: Simulation de trajectoires d’émission compatibles avec le budget carbone +2° C, The Shift Project, Paris 2017. Online unter: https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2017/12/note_danalyse_les_indc_et_le_budget_carbone_the_shift_project_0.pdf[Stand: 2.5.2020].
110Die Luftfahrtbranche einigte sich im Herbst 2016 auf ein eigenes (allerdings recht schwaches) Abkommen. Für den Schiffsverkehr wurde eine Einigung im April 2018 verkündet. Demnach sollen die Emissionen der Branche bis 2050 halbiert werden.
111Vgl. Scheidler, Fabian: Chaos, a. a. O., S. 200.
112Zitiert nach: Milman, Oliver: James Hansen, father of climate change awareness, calls Paris talks ›a fraud‹. Online unter: http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud[Stand: 2.5.2020].
113Vgl. Brand, Ulrich: »Umwelt« in der neoliberal-imperialen Politik. Sozial-ökologische Perspektiven demokratischer Gesellschaftspolitik, in: Widerspruch 54, Zürich 2008, S. 139–148.
114World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford 1987, S. 43.
115Vgl. Heinberg, Richard: Jenseits des Scheitelpunkts, Waltrop/Leipzig 2012, S. 114.
Читать дальше