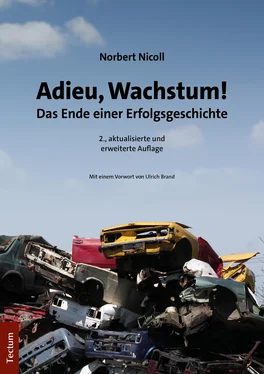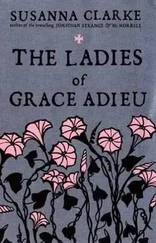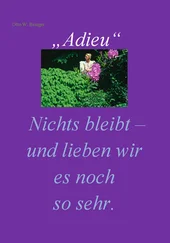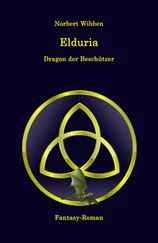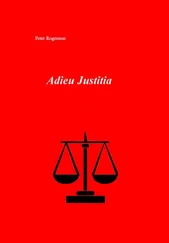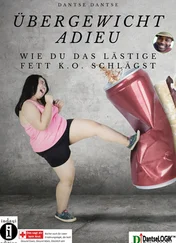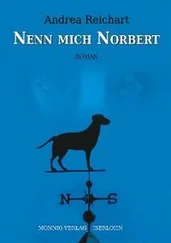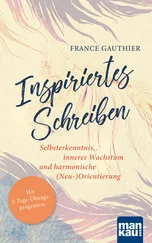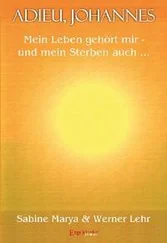1 ...7 8 9 11 12 13 ...32 Sehr viele Küstenstädte würden im Meer versinken. Gefährdet wären dann zum Beispiel Teile Belgiens und der Niederlande, Bangladesch, die US-amerikanische Ostküste und die nordchinesische Tiefebene. Die Auswirkungen wären immens – zwei Drittel der Weltbevölkerung wohnen höchstens 320 Kilometer von einer Küste entfernt. Außerdem ist ein Großteil der Weltwirtschaft in Küstenstädten konzentriert. 84
Und schließlich: Die globale Erwärmung verändert den Wasserkreislauf. Es verdampft mehr Wasser. Das führt zu mehr und stärkeren Stürmen und Niederschlägen. Das ist die Theorie. In der Praxis lässt sich genau das auch auf der nördlichen Erdhalbkugel nachweisen – dort nahmen Verdunstung und Niederschlag tatsächlich in den letzten 30 Jahren zu, wie Satellitenmessungen zeigen. Im Süden kann man diesen Effekt noch nicht nachweisen. Dort sind mit den Klimaphänomenen El Niño und La Niña Sonderentwicklungen zu beobachten. 85
Die Verantwortung der reichen Staaten
Bei der Fortsetzung des derzeitigen Trendpfades steuert die Erde bis zum Jahr 2100 auf einen Anstieg der globalen Mitteltemperatur um mehr als 3 Grad Celsius zu.
Die bisherige Entwicklung beschreibt das Szenario RCP 8.5 des Weltklimarates am besten. 86RCP 8.5 gilt eigentlich als Worst-Case-Szenario. Es rechnet mit einer durchschnittlichen globalen Temperaturzunahme von 3,3 bis 5,4 Grad Celsius bis zum Jahr 2100.
Von den im Pariser Klimaschutzabkommen angestrebten 1,5 Grad Celsius sind wir meilenweit entfernt. Verantwortlich für den Klimawandel wie auch für die immensen Umweltschäden sind in erster Linie die entwickelten Länder. In den Industrieländern werden pro Einwohner durchschnittlich 13 Tonnen CO2 in die Luft geblasen, während in den ärmsten Ländern lediglich 1,4 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr im Durchschnitt emittiert werden. 87Der durchschnittliche Deutsche emittierte übrigens 2017 8,89 Tonnen CO2 pro Jahr. Zielmarke, um den Klimawandel zu begrenzen, müssten etwa 2 Tonnen pro Kopf pro Jahr sein. 88
Die hochindustrialisierten Länder als Hauptverursacher des Schlamassels werden allerdings nicht so stark von den bevorstehenden Herausforderungen tangiert sein wie die armen Länder, Erstere tragen nur 3 Prozent der Kosten. 89Am härtesten werden die tropischen und subtropischen Klimaregionen der Erde unter dem Klimawandel zu leiden haben. Diese Regionen umfassen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung und schließen u. a. weite Teile Südamerikas, Chinas und Indiens mit ein. 90Afrika südlich der Sahara könnte beispielsweise bei einer globalen Erwärmung um 1,5 bis 2 Grad im Durchschnitt schon bis zum Jahr 2030 rund 40 bis 80 Prozent der Fläche, auf der heute noch Mais und Hirse angebaut werden, durch Trockenheit verlieren. Mit gravierenden Folgen für die Zahl hungernder Menschen. 91
Der Klimawandel verhält sich nicht-linear. Die sogenannten Kippvorgänge (auch Tipping Points genannt) könnten sehr bedeutsam werden. Diese können bestimmte Prozesse stark beschleunigen. Zu denken ist u. a. an:
• Die Permafrostböden. Der arktische Boden enthält über 1,8 Billionen Tonnen Kohlenstoff – mehr als doppelt so viel, wie sich derzeit in der Erdatmosphäre befindet. 92Ein Auftauen der Permafrostböden würde gespeichertes Methan, das weitaus klimawirksamer ist als CO2, entweichen lassen – der Klimawandel könnte sich damit selbst antreiben.
• Die Meere und Ozeane. Wenn sie sich stärker erwärmen, entweicht auch hier gebundenes Methan. Zudem sinkt der pH-Wert durch die Aufnahme von Kohlendioxid immer weiter – sie versauern. Somit können sie ihre Rolle als Kohlenstoffsenke immer schlechter wahrnehmen und weniger CO2 aufnehmen.
• Den Amazonas-Regenwald: Der Klimawandel könnte eine kritische Austrocknung des Gebiets verursachen. In diesem Fall könnte dieses selbsterhaltende Regenwaldsystem zusammenbrechen (verstärkt durch die Abholzung des Regenwaldes). Nicht nur wäre damit das artenreichste Ökosystem der Erde zerstört, die aus den Pflanzen frei werdenden Mengen an Kohlendioxid würden dem Klimawandel zudem einen zusätzlichen gewaltigen Schub geben.
• Die bisherigen Dauereisflächen. Wenn sie an den Polen und in den Bergen verschwinden, wird weniger Sonnenstrahlung reflektiert und die Erwärmung beschleunigt sich. 93
Was müsste getan werden? Um eine Antwort geben zu können, muss man etwas weiter ausholen. Ob die Klimaziele erreicht werden, wird hauptsächlich von der Entwicklung des Energiesektors abhängen. Der Anstieg der Kohlendioxidemissionen ist nämlich in erster Linie der Zunahme fossiler CO2-Emissionen durch den Energiesektor geschuldet.
Der globale Energieverbrauch ist im 20. Jahrhundert pro Kopf um 800 Prozent gestiegen. Im 21. Jahrhundert hat sich das starke Wachstum des Energiebedarfs fortgesetzt. 94Und das soll so weitergehen: Die Internationale Energie-Agentur (IEA) mit Sitz in Paris sieht den weltweiten Energiebedarf zwischen 2019 und 2040 um etwa 25 Prozent ansteigen. Der Anstieg liege bei gut 1 Prozent pro Jahr. Die CO2-Emissionen, die mit Energieerzeugung verbunden sind, werden der IEA-Prognose nach bis 2040 nicht sinken, sondern weiter steigen. 95
Eine klare Ansage. Nicht minder klar sind die Forderungen des Weltklimarates:
• Die industrialisierten Länder müssen ihre Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 vermindern, so der vierte Sachstandsbericht des Weltklimarates. 96
• Schwellen- und Entwicklungsländer müssen ihre Emissionen bis 2050 auch absenken, aber in ihrem Fall muss die Kurve nicht ganz so scharf ausfallen.
• Die weltweite Menge an Emissionen müsste insgesamt schon jetzt sinken und dann stetig abnehmen, damit sie global bis zum Jahr 2050 um 50 bis 85 Prozent im Vergleich zum Jahr 2000 geringer ausfällt.
Paul Ekins und Christophe McGlade vom Institute for Sustainable Resources am University College London haben in einer Anfang 2015 publizierten Studie berechnet, wie viele der im Boden vorhandenen fossilen Rohstoffe dort verbleiben müssen, um zumindest das 2-Grad-Ziel mit einer erheblichen Wahrscheinlichkeit 97zu erreichen. Ergebnis: Mindestens 80 Prozent der Kohlereserven, 50 Prozent der Gasreserven und zwei Drittel der Ölreserven müssten unangetastet bleiben. Ekins und McGlade formulieren in ihrer Studie auch klare Empfehlungen zur geographischen Verteilung des Nicht-Verbrauchs. Der größte Teil der Kohlereserven in China, Russland und den USA dürfte demnach nicht verbrannt werden. Gleiches gilt für große Teile der Ölreserven im Nahen und Mittleren Osten (etwa so viel wie die gesamten Ölreserven Saudi-Arabiens). Der Nahe Osten müsste zudem mehr als 60 Prozent seiner Gasreserven im Boden belassen. 98
Damit ist klar: Das Energiesystem muss umfassend umgebaut werden. Drei grundlegende Sachverhalte sind in diesem Zusammenhang zu beachten:
• Energie ist die Bedingung für praktisch jede Arbeit und somit für jede wirtschaftliche Aktivität.
• Die Verbrennung fossiler Brennstoffe befriedigt rund 80 Prozent des Energieverbrauchs der Welt. 99
• Die Investitionen in die Energieinfrastruktur sind ebenso enorm wie langfristig, ihre Lebensspanne umfasst 30 bis 50 Jahre.
Unter diesen Umständen, so schlussfolgert der belgische Umweltaktivist Daniel Tanuro, stellt die Rettung des Klimas bei gleichzeitiger Respektierung der Nord-Süd-Gerechtigkeit eine kollektive Anstrengung dar, die in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft ohne Beispiel ist. 100
64Diese Feststellung bezieht sich auf einen Zeitraum von 100 Jahren. Die Wirkung von Methan ist in den ersten 10 bis 15 Jahren nach seiner Freisetzung allerdings am stärksten. Sie ist dann 86-mal höher als von CO2. Vgl. dazu Klein, Naomi: Die Entscheidung: Kapitalismus vs. Klima, Frankfurt am Main 2015, S. 180.
65Vgl. The World Bank (Hg.): Turn Down the Heat: Why a 4 °C Warmer World Must be Avoided, 1. Teilstudie, Executive Summary, Washington D. C. 2012, S. 2. Online unter: http://documents.worldbank.org/curated/en/362721468153549916/pdf/632190WP0Turn000Box374367B00PUBLIC0.pdf[Stand: 26.5.2020].
Читать дальше