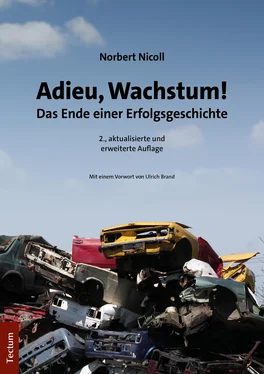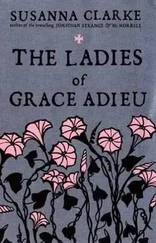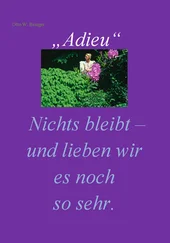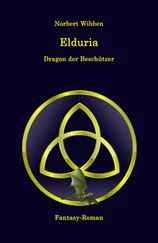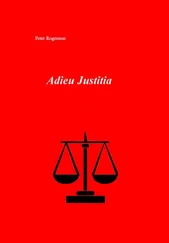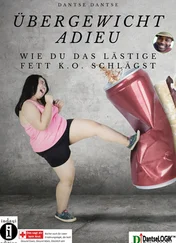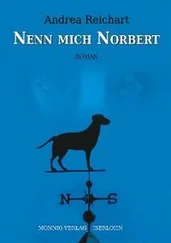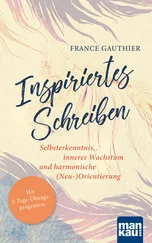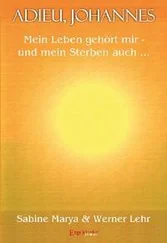;Angela Merkel, Bundeskanzlerin, im November 2007
5. Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit
Gemessen an den Notwendigkeiten müsste es im Bereich der Nachhaltigkeit reihenweise große Würfe geben. Müsste. Die Wirklichkeit sieht anders aus.
Ein Autorenteam der Wirtschaftsuniversität Wien brachte 2019 die bittere Realität auf eine treffende Formel: Die Menschheit praktiziere »nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit« 101.
Beispiele gefällig? Immer mehr Menschen kaufen online ein – der Verpackungsmüll hat bisher nie erreichte Rekordmengen erreicht. Um den Energiehunger der Zukunft zu stillen, gehen weltweit immer noch gigantische fossil betriebene Kraftwerke ans Netz. Die Luftfahrtbranche rechnet mit einer jährlichen Zunahme des globalen Luftverkehrs von 4 bis 5 Prozent in den kommenden zwei Jahrzehnten. Covid-19 ist aus ihrer Sicht nur eine vorübergehende Wachstumsdelle. Ähnlich die Planungen der Automobilindustrie: Sie sieht eine gewaltige Kapazitätserhöhung vor. Das heißt: Der aktuelle Bestand von rund einer Milliarde Fahrzeugen weltweit soll bis 2050 auf bis zu 2,5 Milliarden Autos steigen. 1021980 waren weltweit noch 370 Millionen Autos unterwegs. Große Schwellenländer wie China sprengen alle Dimensionen: Die PKW-Flotte im Reich der Mitte wuchs in den vergangenen Jahren um ca. 20 Prozent pro Jahr. 103In Europa wächst die Fahrzeugflotte derweil kaum noch – dafür werden auf dem alten Kontinent aber immer mehr SUV zugelassen. Inzwischen gehört in Westeuropa etwa jeder dritte Neuwagen dieser Fahrzeugkategorie an. SUV verbrauchen mehr Kraftstoff als vergleichbare Limousinen – und emittieren mehr CO2.
In ganz Europa sind derweil vor den Gerichten Hunderte Prozesse gegen den Bau von Windrädern anhängig, die von Anwohnern initiiert wurden, die sich gegen die angebliche Verschandelung der Landschaft wehren. 104Wer geglaubt hatte, wir würden uns in Selbstbeschränkung üben, sieht sich getäuscht.
Das illustriert nichts besser als die gescheiterte Yasuní-ITT-Initiative von Ecuador. Dessen Regierung um den damaligen Präsidenten Rafael Correa wollte darauf verzichten, in einem besonders artenreichen Regenwaldabschnitt nach Erdöl zu bohren. Im Gegenzug sollten andere Staaten das kleine lateinamerikanische Land teilweise für seine entgangenen Öleinnahmen entschädigen.
Das Projekt war von Anfang an umstritten. 105Das UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, richtete dennoch einen Treuhandfonds ein. In diesen Fonds sollte zumindest die Hälfte des Betrags eingezahlt werden, den Ecuador durch die Ölförderung eingenommen hätte. Schätzungen zufolge wären das etwa 3,6 Milliarden Dollar gewesen. 850 Millionen Barrel Erdöl wären bei einem Erfolg der Initiative nicht gefördert worden. Damit hätten 407 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können. 106Doch aus dem einmaligen Vorhaben wurde nichts. Sechs Jahre nach dem Start der Initiative gingen nur 13,3 Millionen US-Dollar (0,37 Prozent des erwarteten Betrages) ein. Ein trauriger Rafael Correa erklärte im Sommer 2013 den Stopp des Projektes. Ecuador brauche das Geld für seine Wirtschaftsentwicklung. 1072016 ging die erste Bohrplattform in Betrieb – die Yasuní-ITT-Initiative war krachend gescheitert.
Der Kyoto-Prozess
Das Exempel schlechthin für desaströse Entscheidungen sind die Klimaverhandlungen der letzten Jahre. Der Handlungsdruck ist eigentlich enorm. Gemessen daran sind die Ergebnisse der großen Klimagipfel der letzten Jahre absolut unzureichend. Die Gipfel produzierten in schöner Regelmäßigkeit viel heiße Luft und nur wenige konkrete Ergebnisse.
Das Kyoto-Protokoll von 1997 war der Einstieg in internationale Klimaverhandlungen mit verbindlichen Reduktionszielen und insofern ein wichtiger Schritt. Doch der in Japan geschlossene Vertrag war eindeutig nicht weitreichend genug. Das Ziel des Protokolls – die Signatarstaaten 108verpflichteten sich, ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2012 um durchschnittlich 5,2 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu verringern – wurde zwar erreicht, konnte aber die globale Erwärmung nicht entscheidend bremsen. Denn im Gegenzug haben die Länder, die sich in der japanischen Metropole zu nichts verpflichten ließen oder ganz außen vor blieben, in den letzten Jahren diesen kleinen Erfolg konterkariert. Weltweit sind die Treibhausgasemissionen seit 1990 um über 50 Prozent gestiegen.
2012 lief das Kyoto-Protokoll aus – ohne Nachfolgeabkommen. Bei der Konferenz in Doha, der Hauptstadt Katars, im Dezember 2012 wurde ein Scheitern des Gipfels nur dadurch vermieden, dass das Kyoto-Protokoll bis zum Jahr 2020 als Kyoto II verlängert wurde. Die Verlängerung des Kyoto-Protokolls als Kyoto II ist vor allem eines: Symbolpolitik. Bei der zweiten Verpflichtungsperiode, die von 2013 bis 2019 lief, machten nur noch knapp 40 Staaten mit. Neben den Ländern der Europäischen Union waren u. a. Australien, Norwegen und die Schweiz mit im Boot. Andere wichtige Länder wie Kanada, Japan oder Russland waren ausgestiegen, so dass auf die Kyoto-II-Staaten weniger als 15 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen entfielen.
Dann folgte im Dezember 2015 die große Klimakonferenz in Paris. Das Ergebnis wurde von der Politik und von den Medien als großer Erfolg gefeiert. Endlich, so hieß es, hat ein großer Gipfel mal ein Ergebnis gebracht. Das stimmt – aber was für eins? Bei Lichte betrachtet ist das Paris-Protokoll eine gute Übung, sich selbst und der Welt etwas vorzumachen. Der Vertrag bleibt sehr weit hinter dem Notwendigen zurück.
Diplomatischer Scheinerfolg in Paris
Zwei Lichtblicke gibt es: Erstens, dass es überhaupt eine Einigung gab und dass alle Staaten (195 an der Zahl) mit im Boot sind. Zweitens: Im Vertrag steht, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts begrenzt werden soll. Das erklärte Ziel liegt bei 1,5 Grad Celsius.
Das Problem: Während das Ziel richtig und ehrgeizig ist und alle Vertragsstaaten sich auch zu diesem Ziel bekennen, sind die Instrumente zur Zielerreichung unzureichend. Denn die Formel lautet: Freiwilligkeit. Jedes Land hat in Paris freiwillige nationale Emissionsziele vorgelegt. Mit anderen Worten: Jedes Land darf selbst entscheiden, ob, wann und wie viel Emissionen es reduziert. Sanktionen bei der Zielverfehlung? Gibt es nicht. Mehr noch: Selbst wenn alle Staaten ihre in Paris vorgelegten Klimaschutzpläne einhalten sollten, bleibt der Kohlendioxidausstoß drastisch zu hoch.
Immerhin: Seit dem Klima-Gipfel 2018 in Kattowitz gibt es auch ein Regelwerk für das Pariser Abkommen. Jenes Regelwerk legt fest, dass es für alle Staaten einheitliche Transparenzregeln und Standards bei der Erfassung gibt. Dadurch sollen die Fortschritte bei der CO2-Reduktion vergleichbar gemacht werden. Die Konferenz 2019 in Madrid war dagegen wieder ein Rückschlag: Die Ergebnisse waren minimal, einige bedeutende Staaten wie zum Beispiel Brasilien oder Australien versuchten das Pariser Abkommen aufzuweichen.
Scheitern absehbar
Sehr wahrscheinlich ist, dass die Welt den selbstgesteckten Zielkorridor von 1,5 Grad Erwärmung deutlich verfehlen und bei mehr als 3 Grad Celsius Erwärmung landen wird. 109
Echte Verantwortung für die Klimaschäden wollten die entwickelten Länder in Paris und auch bei den Folgekonferenzen nicht übernehmen – erst recht nicht in Form von Wiedergutmachungszahlungen. Immerhin: Es gibt finanzielle Anpassungshilfen für weniger entwickelte Länder. Nach Ansicht aller Beobachter fallen die Finanzversprechen für den Technologietransfer in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr ab 2020 aber deutlich zu gering aus. Eine Billion Dollar wäre pro Jahr notwendig, also das Zehnfache. Zudem müssen die Details der Finanzierung noch geklärt werden.
Weiteres Problem: Die Emissionen aus dem grenzüberschreitenden Güterverkehr werden im Pariser Abkommen formell keinem Staat zugeschrieben. Der gesamte Luft- und Schiffsverkehr war ursprünglich vom Vertrag ausgenommen. 110Gleiches gilt immer noch für die globale Zementproduktion. Diese sorgt für 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen und emittiert damit in etwa doppelt so viel Kohlendioxid wie der Flugverkehr. 111
Читать дальше