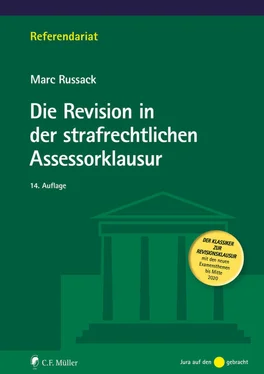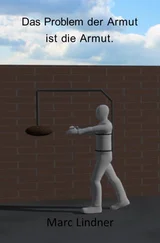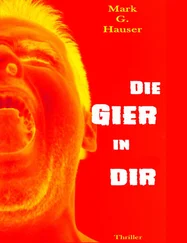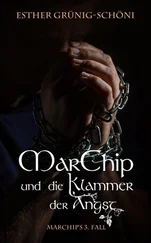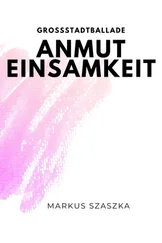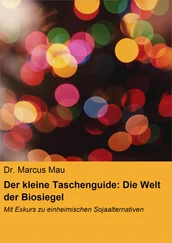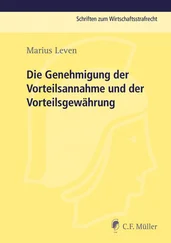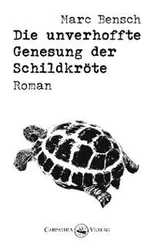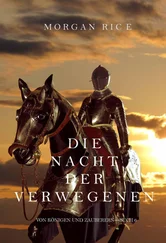55
2. Mitunter sind die Klausurfälle so konstruiert, dass eine an den Angeklagten oder seinen Verteidiger erfolgte – und länger als einen Monat zurückliegende – Urteilszustellung aus bestimmten Gründen unwirksamwar. Da die Frist des § 345 Abs. 1 S. 2 StPO nur durch eine wirksame Zustellung in Gang gesetzt wird (vgl. M-G/S § 345 Rn. 5), führt dies zu dem für den Angeklagten günstigen Ergebnis, dass die Revisionsbegründungsfrist nur scheinbar abgelaufen ist. Hier sind insbesondere folgende Konstellationen denkbar:
56
a) Eine erste Besonderheit kann sich aus § 36 Abs. 1 S. 1 StPO ergeben, wonach der Vorsitzende die Zustellung von Entscheidungen anordnet. Eine ohne Anordnung des Vorsitzendenerfolgte Zustellung ist unwirksam (vgl. M-G/S § 36 Rn. 7).
57
In einem Klausurfall war die Verfügung des Vorsitzenden enthalten, in der dieser die Zustellung des angefochtenen Urteils an den Verteidiger angeordnet hatte. Die Geschäftsstelle hatte die Zustellung stattdessen allerdings (nur) an den Angeklagten selbst veranlasst – bei deren Maßgeblichkeit wäre die Revisionsbegründungsfrist abgelaufen gewesen. Die Unwirksamkeit der Zustellung ergab sich hier – so ein bisweilen vorkommender Klausurfehler – nicht bereits aus §§ 37 Abs. 1 StPO, 172 Abs. 1 S. 1 ZPO, da im Strafverfahren – wie sich aus § 145a Abs. 3 StPO ergibt – auch bei Vorhandensein eines zustellungsbevollmächtigten Verteidigers keine Rechtspflicht zu Zustellungen an diesen besteht (vgl. M-G/S § 145a Rn. 6). Der sich vielmehr aus § 36 Abs. 1 S. 1 StPO ergebende Zustellungsmangel wurde anschließend gem. §§ 37 Abs. 1 StPO, 189 ZPO dadurch geheilt, dass der Angeklagte seinem Verteidiger die Urteilsausfertigung bei Erteilung des Rechtsmittelauftrags übergab, die damit „tatsächlich zugegangen“ war. Zu diesem Zeitpunkt war die Monatsfrist des § 345 Abs. 1 StPO allerdings noch problemlos einzuhalten.
58
Die Wirksamkeit der Zustellungsanordnung setzt die eindeutige richterliche Bezeichnung des Zustellungsempfängers voraus. Hiergegen ist nicht nur verstoßen, wenn der Vorsitzende überhaupt keinen Zustellungsempfänger angibt – wie etwa in dem Klausurfall, in dem er der Geschäftsstellenbeamtin das Urteil mit den Worten „zwecks Zustellung zur weiteren Veranlassung in eigener Zuständigkeit“ übergab –, sondern auch dann, wenn er bei Vorhandensein mehrerer Verteidiger lediglich die „Zustellung des Urteils an Verteidiger“ anordnet (vgl. M-G/S § 36 Rn. 4). In diesem Klausurfall wurde die Revisionsbegründungsfrist daher erst durch eine spätere Zustellung in Gang gesetzt, der die konkrete Vorsitzendenanordnung „Zustellung des Urteils an Rechtsanwältin Dr. Hoffmann“ zu Grunde lag.
59
b) Bei der Urteilszustellung an den Angeklagten selbst sind Fehler bei der praktisch wichtigen Ersatzzustellungdenkbar. Hier sind insbesondere die Voraussetzungen der über § 37 Abs. 1 StPO anwendbaren §§ 178, 180, 181 ZPO sorgfältig zu überprüfen (vgl. M-G/S § 37 Rn. 6 ff.).
60
In einem leicht aus dem Kommentar zu lösenden Klausurfall war die – im Falle ihrer Wirksamkeit zur Unzulässigkeit der Revision führende – Ersatzzustellung an die Mutter des Angeklagten erfolgt, der sich selbst zu diesem Zeitpunkt allerdings schon seit über einem halben Jahr in Untersuchungshaft befand. „Wohnung“ i.S. des § 178 Abs. 1 Nr. 1 ZPO ist jedoch nur diejenige Räumlichkeit, die der Adressat zum Zeitpunkt der Zustellung tatsächlich für eine gewisse Dauer zum Wohnen benutzt. Eine Ersatzzustellung ist daher nicht wirksam, wenn die Räume längere Zeit nicht benutzt werden, wie etwa bei längerer Straf- oder Untersuchungshaft (so BGH NJW 1978, 1858 schon bei knapp zweimonatiger Haft; vgl. auch M-G/S § 37 Rn. 8, 9).
61
c) Bei Urteilszustellung an den Verteidiger kann sich ein weiterer Zustellungsmangel daraus ergeben, dass der Verteidiger, dem das Urteil zugestellt werden sollte, in einer aus mehreren Rechtsanwälten zusammengeschlossenen Sozietätbeschäftigt ist. Hier passiert es bisweilen, dass nicht dieser selbst, sondern ein Sozius das bei derartigen Zustellungen regelmäßig verwendete Empfangsbekenntnis(§§ 37 Abs. 1 StPO, 174 ZPO) unterzeichnet. Eine so mitunter auch im Examen vorkommende Zustellung ist im Falle der Pflichtverteidigungausnahmslos unwirksam (vgl. M-G/S § 37 Rn. 19). Im Falle der Wahlverteidigung gilt dies, wenn der unterzeichnende andere Anwalt nicht selbst zustellungsbevollmächtigt ist.
62
Um ein Empfangsbekenntnis ging es auch in der Examensklausur, in der die Erfolgsaussichten einer Revision der Staatsanwaltschaft zu begutachten waren. Das die Urteilszustellung betreffende Empfangsbekenntnis war einen Monat und einen Tag vor dem Begutachtungszeitpunkt von einem Wachtmeister der Staatsanwaltschaft unterzeichnet worden – die Urteilsausfertigung selbst übergab dieser dann drei Tage später dem vom Behördenleiter zum Empfang bevollmächtigten Staatsanwalt. Auch wenn Zustellungen an die Staatsanwaltschaft aus Gründen der Vereinfachung nach § 41 StPO grundsätzlich durch Vorlegung der Urschrift des zuzustellenden Schriftstücks erfolgen, wird die Zustellung nach § 37 StPO – auch i.V. mit § 174 ZPO – dadurch nicht ausgeschlossen. Für deren Wirksamkeit ist dann jedoch die Unterzeichnung des Empfangsbekenntnisses durch den Behördenleiter oder die ihn vertretende – sachkundige – Person erforderlich (vgl. M-G/S § 41 Rn. 1). Die Frist des § 345 Abs. 1 S. 2 StPO wurde damit erst durch die tatsächliche Übergabe des Urteils an den empfangsbevollmächtigten Staatsanwalt in Gang gesetzt (§§ 37 Abs. 1 StPO, 189 ZPO), so dass sie zum Begutachtungszeitpunkt noch nicht abgelaufen war.
63
d) Bei einer Zustellung des Urteils an den Wahlverteidigerist überdies § 145a Abs. 1 StPOzu beachten. Die in dieser Vorschrift normierte gesetzliche Zustellungsvollmachtdes Wahlverteidigers – der Pflichtverteidiger ist nach dieser Norm ohnehin uneingeschränkt zustellungsbevollmächtigt – gilt ausnahmslos nur für den Fall, dass sich dessen schriftliche Vollmacht bei den Akten befindet. Die bloße Versicherung des Wahlverteidigers, er sei ordnungsgemäß bevollmächtigt, kann dieses Erfordernis nicht ersetzen.
64
Da sich die Vollmacht des Wahlverteidigers – wie sich aus dem Bearbeitungsvermerk ergab – in einem insoweit einschlägigen Klausurfall zum Zeitpunkt der Urteilszustellung an ihn allerdings noch nicht bei den Akten befand, war allein die (spätere) Zustellung an den Angeklagten selbst maßgeblich, so dass die Revisionsbegründungsfrist zum Begutachtungszeitpunkt doch noch eingehalten werden konnte. Mit dem bereits oben[6] angesprochenen § 37 Abs. 2 StPO hatte dieses Ergebnis allerdings deshalb nichts zu tun, weil hier mehrere wirksame Zustellungen gerade nicht vorlagen (vgl. M-G/S § 37 Rn. 29).
65
In einem anderen Klausurfall war dem Wahlverteidiger das Urteil (deutlich früher als einen Monat vor dem Begutachtungszeitpunkt) zugestellt worden, obwohl dieser dem Gericht zuvor mitgeteilt hatte, dass er den Angeklagten nicht länger vertrete. Die Zustellung erwies sich hier deshalb als unwirksam, weil die Zustellungsvollmacht des § 145a Abs. 1 StPO nach Beendigung des Mandats nur solange fortwirkt, bis die Anzeige des Angeklagten oder seines Verteidigers über das Erlöschen des Verteidigerverhältnisses zu den Akten gelangt (vgl. M-G/S § 145a Rn. 11).
66
In einer weiteren Examensklausur waren die Themen der §§ 145a Abs. 1, 37 Abs. 2 StPO miteinander verbunden. Einstieg in das Zulässigkeitsproblem war, dass der Begutachtungszeitpunkt genau auf den ersten Tag nach Ablauf der durch die Urteilszustellung an den 1. Verteidiger ausgelösten Revisionsbegründungsfrist gelegt war. Der Angeklagte hatte für das Revisionsverfahren aber einen 2. Verteidiger gewählt und diesem eine Strafprozessvollmacht erteilt, die ausdrücklich auch die Ermächtigung zur Inempfangnahme von „Zustellungen aller Art, insbesondere von Ladungen, Urteilen und Beschlüssen“ enthielt. Diesem Verteidiger war das Urteil gut eine Woche nach dem 1. Verteidiger zugestellt worden, was den Einstieg in § 37 Abs. 2 StPO ermöglichte. Allerdings hatte der 2. Verteidiger diese Vollmacht erst zwei Tage nach der Urteilszustellung an ihn selbst zu den Akten gereicht, so dass sich deren – für die Anwendung des § 37 Abs. 2 StPO vorauszusetzende – Wirksamkeit nicht bereits aus § 145a Abs. 1 StPO ergeben konnte. Da er aber schon mit Erteilung dieser rechtsgeschäftlichen– und über die gesetzliche Bevollmächtigungsfiktion des § 145a Abs. 1 StPO hinausgehenden – Zustellungsvollmachtempfangsberechtigt war, erwies sich die 2. Zustellung unter diesem Gesichtspunkt als wirksam, so dass sich die Revisionsbegründungsfrist am Ende doch nach dieser „zuletzt bewirkten Zustellung“ (§ 37 Abs. 2 StPO) richtete und damit eingehalten werden konnte. Zum Nachweis der rechtsgeschäftlichen Vollmacht reichte es aus, dass diese wenige Tage nach der 2. Zustellung zu den Akten gereicht wurde (vgl. M-G/S § 145a Rn. 2a). Der Unterschied zwischen rechtsgeschäftlicher und gesetzlicher Zustellungsvollmacht liegt im Übrigen darin, dass letztere zur Vereinfachung des Zustellungswesens vom Willen des Angeklagten unabhängig ist – also auch dann gilt, wenn die dem Verteidiger erteilte Vollmacht die Inempfangnahme von Zustellungen gerade nicht umfasst.
Читать дальше