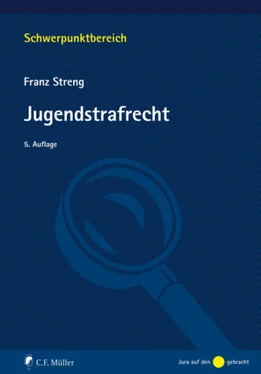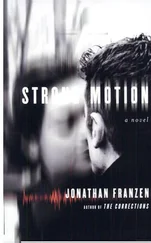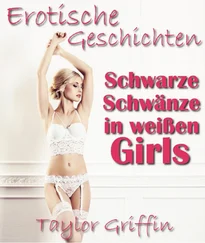8
Besonderer Erwähnung bedarf die direkte und indirekte Drogenkriminalität, bei der die Jugendlichen und Heranwachsenden weit überrepräsentiert sind. Neben eigentlichen Betäubungsmitteldelikten, die über Jahrzehnte hinweg bis zum Jahr 2004 nahezu kontinuierlich im Anstieg begriffen waren[28], werden von drogensüchtigen jungen Menschen vor allem Eigentumsdelikte und leichtere Formen des Raubes (Handtaschenraub) begangen, die der Finanzierung des Drogenkonsums dienen. Drogenabhängigkeit ist zunächst ein individuelles Problem, jedoch in ihrer auch gesellschaftlichen Bedingtheit unverkennbar. Sie entsteht oft infolge defizitärer emotionaler und/oder struktureller Einbindung von Kindern und Jugendlichen in ihre Herkunftsfamilie und auf Grund von Schwierigkeiten, die im Rahmen der Reifung anstehenden Entwicklungsaufgaben zu meistern, also in eine Erwachsenenrolle hineinzuwachsen. Zum anderen führt die Unfähigkeit der Gesellschaft, das illegale (wie legale) Drogenangebot besser zu kontrollieren, zu – oftmals peer group -induzierten – Probierhandlungen mit anschließender Verfestigung von Konsum in Form einer Sucht bei den dafür Anfälligen[29].
9
Doch ist Jugendkriminalität beileibe nicht immer oder auch nur überwiegend Endpunkt einer sich verschärfenden Krise. Abweichendes Verhalten ist gerade im Jugendalter zumeist punktuelles oder temporäres Ereignis[30]. Als Warnzeichen hinsichtlich einer drohenden kriminellen Karriere gilt Kinder- und Jugendkriminalität erst bei wiederholten schweren Delikten oder bei sehr früher und nachhaltiger Kinderkriminalität[31]. Von daher wird von Kriminologen ganz berechtigt empfohlen, Jugendkriminalität nicht zu dramatisieren, insbesondere mit Strafrechtseinsatz möglichst zurückzuhalten. Es geht dann darum, einem „Selbstheilungsprozess“ möglichst wenig im Wege zu stehen. Denn der strafrechtliche Zugriff stellt ein höchst isoliertes Ereignis mit daher nur geringen sozialisationsfördernden Potenzialen dar, das andererseits den Jugendlichen in schädlicher Weise als Abweichler abstempeln kann[32]. Eine stärker interventionsorientierte Perspektive verfolgt man für die von Polizei und Politikern immer wieder hervorgehobenen „jugendlichen Intensivtäter“. Hierbei handelt es sich um – jedenfalls temporär – besonders auffällige Rückfalltäter, über deren pädagogische Beeinflussbarkeit und weitere Entwicklung mit dem Etikett des Intensivtäters[33] noch wenig ausgesagt ist[34].
Da mit diesen Hinweisen gewiss keine erschöpfende Behandlung der jugendkriminologischen Fragestellungen geleistet ist, sei insoweit auf einschlägige kriminologische Literaturverwiesen[35]. Befunde zur Effizienzverschiedener Reaktions- und Sanktionsformen des Jugendstrafrechts werden später (in §§ 10 – 12) im Zusammenhang mit den juristischen Fragen dargestellt werden.
Teil I Einführung› § 1 Grundsätzliches zur Jugendkriminalität und zu den Aufgaben der Jugendstrafrechtspflege› II. Warum ein besonderes Jugendstrafrecht?
II. Warum ein besonderes Jugendstrafrecht?
10
Bereits das statistische Faktum der knapp dreifachen Überrepräsentierung der Jugendlichen und Heranwachsenden unter den Tatverdächtigen (vgl Schaubild 1 ) lässt erkennen, dass es nicht etwa eine Aufgabe minderer Bedeutung und Herausforderung für die Justiz darstellt, wenn man es „nur“ mit jungen Beschuldigten zu tun hat. Ganz im Gegenteil erfordert das kritische Übergangsstadium zwischen Kindheit und Erwachsenenalter als ganz offenbar „sensible Phase“ der Sozialisationeinen behutsamen und individualisierenden Zugriff auf den jungen Rechtsbrecher bzw Verdächtigen. Daher gewinnen im Jugendstrafrecht als Sonderstrafrecht für junge Täter die Grundprinzipien der Mäßigung in der strafenden Reaktion sowie der Erforschung der Täterpersönlichkeitzum Zwecke einer individualisierenden Reaktion in besonderer Weise Bedeutung[36]. Nachdem der Gedanke der Abschreckung sich als nicht realistisch erwiesen hat und Normbestätigung keine harte Strafe, sondern lediglich eine eindeutige gesellschaftliche Antwort auf Straftaten erfordert, lässt sich gerade im Jugendstrafrecht die Idee des zurückhaltenden Sanktionierens im Sinne von „im Zweifel weniger“mit guten Gründen hochhalten. Befunde aus Rückfallstudien stützen diese Strategie, die auch im Schlagwort von der „Austauschbarkeit der Sanktionen“ ihren Ausdruck gefunden hat[37] – wobei Austauschbarkeit hier nicht Beliebigkeit meint, sondern das Eröffnen von Spielräumen zu Gunsten konstruktiver und unterstützender Sanktionen.
11
Des Weiteren ist auf Erfordernisse „jugendspezifischer Kommunikation“abzustellen[38]. Demzufolge ist das Jugendverfahren anders zu gestalten als das Verfahren des Allgemeinen Strafrechts. Der Ruf nach einer besonderen Kommunikationsstruktur entspricht der Notwendigkeit, die Tathintergründe und erzieherischen Defizite aufzuhellen und den vielfach in der Kommunikationsfähigkeit (noch) eingeschränkten Jugendlichen Hilfestellungen bei der Artikulation ihrer Sichtweise und ihrer Probleme zu leisten. Wichtig ist auch, den Jugendlichen den Eindruck zu vermitteln, fair behandelt zu werden und als Person ernst genommen worden zu sein[39]. Dies bedarf gerade angesichts der zumindest im Allgemeinen Strafverfahren weit im Vordergrund stehenden Objektivierung des Beschuldigten, nämlich der Orientierung an der Wahrheitserforschung und am erfolgsunrechts-orientierten Tatausgleich, der Hervorhebung.
12
Ermöglicht wird die Realisierung dieser Prinzipien durch den im Vergleich zu entsprechenden Taten Erwachsener gegenüber jungen Tätern schwächeren Schuldvorwurf. Folgt man dem auf dem Freiheitspostulat aufbauenden herkömmlichen Schuldbegriff, dann ergibt sich die geringere Schuld schon daraus, dass Jugendliche und auch Heranwachsende noch weit stärker von Dritten – nämlich den Erziehungspersonen – gelenkt und geprägt sind als Erwachsene. Denn jugendliches Fehlverhalten ist weithin von den Eltern oder vom sozialen Umfeld zu verantworten, nicht aber von den jungen Menschen als eigentlichen Opfern der Gefährdungslage. Bei funktionaler Betrachtung ergibt sich die Schuldminderung daraus, dass junge Menschen noch nicht als vollwertige Sozialpartner angesehen werden. Ein Rechtsbruch Jugendlicher löst folglich keine so großen Erschütterungen des Vertrauens in die Normgeltung und demnach auch keine so starken Strafbedürfnisse aus wie eine vergleichbare Tat Erwachsener[40]. Dies schafft Spielräume für eine Zurückdrängung tatorientierter Strategien zu Gunsten täterorientierter.
13
Nicht zuletzt auf dieser Schiene wurde in Teilen der jugendstrafrechtlichen Lehre der Grundsatz entwickelt, dass Jugendliche im Strafrecht keinesfalls schlechter behandelt werden dürften als Erwachsene[41]. Ein Schlechterstellungsverbotlässt sich freilich aus dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz (Art. 3 I GG) nicht herleiten, solange eben die besondere Lage des Jugendlichen auch besondere Maßnahmen erfordert; denn Ungleiches auch ungleich zu behandeln, ist mit dem Gleichheitssatz durchaus vereinbar. Es stellt diese Differenzierungsnotwendigkeit letztlich die Legitimationsbasis eines eigenständigen Jugendstrafrechts dar[42]. Wenn Maßnahmen gegen Jugendliche im Einzelfall stärker belastend ausfallen als gegen Erwachsene in ansonsten vergleichbarer Lage, ist allerdings eine sorgfältige Prüfung angesagt, ob etwa die Grenzen des Schuldangemessenen oder des Verhältnismäßigen, die im Jugendstrafrecht selbstverständlich genauso gelten wie im Allgemeinen Strafrecht, überschritten wurden.
14
Den aufgezeigten Anforderungen an eine verantwortliche Sonderbehandlung junger Täter lässt sich nur in einem auf Verfahrensebene wie auf Rechtsfolgenebene speziell zugeschnittenen Sonderstrafrechtgerecht werden, das sich insbesondere durch Flexibilität auszeichnet[43]. Das deutsche Jugendstrafrecht bleibt dabei eindeutig Strafrecht, folgt also dem „Justizmodell“ (Gerechtigkeitsmodell), nicht aber einem strafrechtsabstinenten Umgang mit Jugendkriminalität nach dem „Wohlfahrtsmodell“, wie es insbesondere in den skandinavischen Ländern praktiziert wird bzw wurde[44]. Der spezifische Zuschnitt unseres Jugendstrafrechts als – zumindest auch – hilfe- und täterorientiert verlangt Konsequenzen für die Ausbildung und Fortbildungder (künftig) in der Jugendstrafrechtspflege Tätigen, insbesondere der Jugendrichter. Jugendkriminologie und forensische Psychologie als außerhalb der juristischen Standardausbildung liegende Disziplinen verdienen für eine verantwortungsvolle Tätigkeit im Rahmen der Jugendjustiz angemessene Beachtung.
Читать дальше