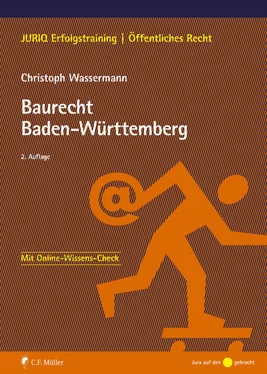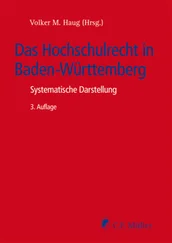160
Im Regelfallwird der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt (Entwicklungsgebot, s.o. Rn. 62 ff.). Der Flächennutzungsplan bedarf gemäß § 6 Abs. 1 BauGB der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Deswegen bedarf der Bebauungsplan im Regelfall keiner Genehmigungdurch die höhere Verwaltungsbehörde. Daher bedürfen nurBebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 S. 2 ( selbständiger Bebauungsplan), Abs. 3 S. 2 (im Parallelverfahren entwickelter Bebauungsplan) und Abs. 4 ( vorzeitiger Bebauungsplan) einer Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Aus § 6 Abs. 2 BauGB folgt, dass die höhere Verwaltungsbehörde den Flächennutzungsplan nur dann versagen darf, wenn dieser formell („nicht ordnungsgemäß zustande gekommen“) oder materiell („diesem Gesetzbuch, den auf Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen oder sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht“) rechtswidrig ist. Es erfolgt also eine Rechtmäßigkeitskontrolle.[77] In inhaltlicher Hinsicht erfolgt somit eine Prüfung anhand des BauGB und aller sonstiger Vorschriften. Ob eine „bessere“ Planung möglich ist ( Zweckmäßigkeitskontrolle) darf die höhere Verwaltungsbehörde nichtprüfen.[78] Wie sich aus § 216 BauGB ergibt, ist die Genehmigung auch dann zu versagen, wenn eine Heilung des Fehlers gemäß § 214 BauGB möglich oder eine Unbeachtlichkeit des Fehlers gemäß § 215 BauGB gegeben wäre.
Hinweis
Die Kontrollbefugnisse der Genehmigungsbehörde reichen also weiter als die der Verwaltungsgerichte.
161
Fehlerfolgen: Die Rechtsfolge eines Verstoßesbesteht in der Beachtlichkeit, § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB. Eine Rügefristnach § 215 Abs. 1 BauGB besteht nicht, da ein Fehler im Genehmigungsverfahren mangels Auflistung der Genehmigung in § 215 BauGB nicht durch Zeitablauf unbeachtlich werden kann. Es kann eine Heilungnach § 214 Abs. 4 BauGB erfolgen.
162

Die Ausfertigung ist im BauGB zwar nicht ausdrücklich erwähnt, als rechtsstaatlicher Grundsatz ist sie jedoch für den Erlass aller Rechtsnormen und somit auch für in Satzungsform erlassene Bebauungspläne (§ 10 Abs. 2 BauGB) erforderlich.[79] Die maßgeblichen Planbestandteile müssen, in der Fassung, in der sie dem Gemeinderatsbeschluss zu Grunde lagen, jeweils einzeln oder in verkörperter Verbindung als authentisch bestätigt und vom Bürgermeister mit Namen und Amtsbezeichnung handschriftlich unterzeichnet werden.[80]
Bei der Ausfertigung handelt es sich um ein kommunalrechtliches Erfordernis. Ihr Sinn und Zweck besteht in der Sicherung der Authentizität, d.h. dass der Bebauungsplan mit dem Willen des Gemeinderates übereinstimmt,[81] und der Legalität, d.h. dass das vorgeschriebene Verfahren eingehalten wurde. Zuständig für die Ausfertigung ist der Bürgermeister. Die Rechtmäßigkeit der Ausfertigung bestimmt sich nach der GemO.
Hinweis
Wegen der Authentizitätsfunktion hat die Ausfertigung nach dem Satzungsbeschluss aber vor der Bekanntmachung zu erfolgen.[82] In Baden-Württemberg verlangt die Ausfertigung nicht die Herstellung einer Originalurkunde; vielmehr genügt auch eine Unterzeichnung des den Satzungsbeschluss enthaltenden Gemeinderatspotokolldeckblatts.[83] Nachfolgende Änderungen sind nur zur rein redaktionellen Richtigstellung möglich.[84]
163
Fehlerfolgen: Die Rechtsfolge eines Verstoßesbesteht in der Nichtigkeitdes Bebauungsplanes. § 215 BauGB greift nicht ein. Möglich ist die Heilungnach § 214 Abs. 4 BauGB durch ein planergänzendes Verfahren.
j) Ortsübliche Bekanntmachung, § 10 Abs. 3 BauGB
164
Bei Bebauungsplänen ist die Erteilung der Genehmigung oder, soweit eine Genehmigung nicht erforderlich ist, der Beschluss des Gemeinderates ortsüblich bekannt zu machen, § 10 Abs. 3 S. 1 BauGB. Die Notwendigkeit einer ortsüblichen Bekanntmachung folgt wegen der Rechtsnatur des Bebauungsplanes als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB ebenfalls aus § 4 Abs. 3 GemO.
Die Bekanntmachung muss so formuliert sein, dass sie einen Hinweis auf den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes gibt und dieser Hinweis den Plan identifiziert. Dadurch tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB der Bebauungsplan in Kraft, § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB. Der Bebauungsplan wird nicht bekannt gemacht. Er ist jedoch mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB zu jedermanns Einsichtbereitzuhalten, § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB.
165
Fehlerfolgen: Die Rechtsfolge eines Verstoßesbesteht in der Beachtlichkeit, § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BauGB, wenn der damit verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht wird. Ferner tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB erst mit der Bekanntmachung in Kraft. Es kann eine Heilungnach § 214 Abs. 4 BauGB erfolgen.
3. Form, § 10 Abs. 1 BauGB
166
In Bezug auf die Form muss der Bebauungsplan als Satzung erlassen werden, § 10 Abs. 1 BauGB (s. hierzu und den Fehlerfolgen oben Rn. 155 ff.).
3. Teil Kommunale Bauleitplanung› C. Die Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplanes und die Folgen eines Verstoßes gegen Vorschriften des BauGB› III. Materielle Rechtmäßigkeit
III. Materielle Rechtmäßigkeit
167
Materielle Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplans[85]
I.Erforderlichkeit des Bebauungsplans
II.Beachtung der gesetzlichen Schranken
III.Beachtung des Abwägungsgebotes
1. Grundsatz der Erforderlichkeit, § 1 Abs. 3 BauGB
168
Aus § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB folgt, dass die Gemeinden die Bauleitpläne, also auch Bebauungspläne, aufzustellen haben, sobald und soweitdies für die städtebauliche Entwicklung erforderlichist. § 1 Abs. 3 BauGB legt damit eine Planungsbefugnisund Planungspflichtder Gemeinde fest. Diese Vorschrift entfaltet sowohl eine Verbots-, eine Einschränkungs-, wie auch eine Gebotswirkung.[86]
169
Da die Bauleitplanung Ausdruck der gemeindlichen Selbstverwaltung gemäß Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG in Form der Planungshoheit (s. Rn. 23) ist, hat die Gemeinde das Recht und ggf. auch die Pflicht, in freier Entscheidung darüber zu befinden, in welcher Weise sie sich städtebaulich geordnet fortentwickeln will.[87] Hierbei handelt es sich nach der Terminologie der GemO um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe.[88] Der Gemeinde kommt inhaltlich, also hinsichtlich des „Wie“,ein weites städtebauliches Ermessenzu. Dies bedeutet, dass weder die Rechtsaufsichtsbehörden noch die Verwaltungsgerichte überprüfen dürfen, ob das von der Gemeinde gewählte planerische Konzept die bestmögliche Lösung für die betreffende Gemeinde darstellt, sofern sich die planerische Konzeption im Rahmen des nach der vorgegebenen Situation Vertretbaren hält.[89] Ansonsten wäre dies ein unzulässiger Eingriff in die kommunale Selbstverwaltungsgarantie.[90]
b) Erforderlichkeit der Planung, § 1 Abs. 3 BauGB
170
Die kommunale Selbstverwaltungsgarantie ist gemäß Art. 28 Abs. 2 S. 1 GG jedoch nur „im Rahmen der Gesetze“ gewährleistet, so dass es zulässig ist, die gemeindliche Planungshoheit gesetzlich zu konturieren und limitieren. So regelt § 1 Abs. 3 BauGB, dass sobald(Zeitkomponente) und soweit(sachlicher/räumlicher Umfang) ein Bauleitplan für die städtebauliche Ordnung erforderlich ist, eine Rechtspflichtder Gemeinde besteht.[91] Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gilt dies auch für Fälle der Umplanung.
Читать дальше