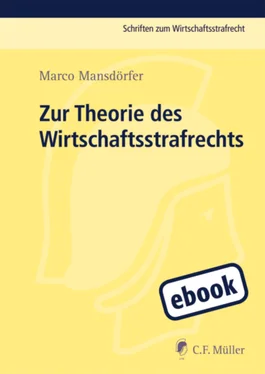Um gleichwohl einen sinnvollen Wirtschaftsrahmen bestimmen zu können, legen private Wirtschaftssubjekte und Hoheitsträger den von Rechts wegen geforderten normativen Standard immer häufiger gemeinsam fest. Die Hoheitsträger beschaffen sich durch Umweltverträglichkeitsprüfungen oder die Beteiligung verschiedenster Interessengruppen in Anhörungs- und Beteiligungsverfahren zunächst die für eine Entscheidung notwendige Information. In einem zweiten Schritt fixieren sie in einer konkreten Verwaltungsentscheidung etwa in Form eines Verwaltungsaktes, eines Planfeststellungsbeschlusses oder eines öffentlich-rechtlichen Vertrages den Handlungsrahmen der einzelnen Wirtschaftsteilnehmer.
d) Ergebnis: Rechtsordnung als Grundlage einer normativ verbindlichen Ordnungsethik
201
Der auf die beschriebene Weise zustande kommende rechtliche Handlungsrahmen bildet für die Ökonomie damit die Grundlage einer normativ verbindlichen Ordnungsethik[439]. Die Rechtsordnung dokumentiert den für die Gesellschaft gefundenen Ausgleich zwischen den Interessenträgern, die Verteilung verschiedener Risiken auf die Mitglieder der Gemeinschaft und den Umgang mit Unsicherheit. Um diese Aufgaben zu erfüllen, verfügt die Hoheitsgewalt über ein breites Spektrum an Handlungsformen, die sie grundsätzlich nach Erfordernissen der Zweckmäßigkeit einsetzen kann. Diese rechtliche Rahmenordnung dient damit zugleich als Handelnsordnung für ökonomisches Verhalten[440]. Grenzen bestehen dort, wo in qualifizierter Weise manipulativ in diese Konstitutionsprozesse eingegriffen wird[441].
Strukturell führt die rechtliche Verhaltensordnung insoweit zu einer ökonomischen Ordnungsethik, als innerhalb der Ordnungsethik eine zur rechtlichen Normenpyramide parallele Konkretisierung der ethischen Grundsätze formuliert werden kann: An der Spitze dieser Pyramide stehen Rechte in Form von Eigentumsrechten, ihnen entgegenstehende Wirtschaftsbürgerrechte und Kommunikationsrechte[442]. Die Stütze dieser Rechte bilden auf mittlerer Stufe sogenannte Rechnungsnormen[443]. Mit derartigen Rechnungsnormen sollen die Anreizstrukturen des Marktes am zentralen Ort der Kostenkalküle aller Marktteilnehmer entsprechend den zunächst formulierten Rechten verändert werden. Um dies zu erreichen, sollen Berechnungsnormen in Form von staatlichen Preisberechnungsvorschriften, wie zum Beispiel bei der Preisbildung am Wohnungsmarkt, oder Sanktionsnormen eine unerwünschte Marktmacht verhindern. Zurechnungsnormen sollen unerwünschte Verteilungseffekte korrigieren[444]. Randnormen sollen als Basis des wirtschaftlichen Handelns den Rahmen definieren, innerhalb dessen ein Markt stattfinden soll[445]. Der Rahmen des Marktes muss freilich auf verschiedene Art und Weise bestimmt werden. So sollen Grenzwerte, etwa in Bezug auf Emissionen, Schadstoffbelastungen, Minimallöhne oder Arbeitszeiten, konkrete Marktergebnisse vorgeben[446]. Normen räumlicher und zeitlicher Marktbegrenzung limitieren Märkte etwa in Form von Zöllen, Ladenöffnungszeiten oder Sperrstunden[447]. Zulassungsnormen machen den Zugang zu einem Markt von der Erfüllung persönlicher Voraussetzungen, wie etwa dem Alter, oder Qualifikationsstandards, etwa Sicherheits- oder Hygienestandards, abhängig[448]. Für bestimmte, insbesondere auch für öffentliche Güter kann der Markt schließlich vollkommen ausgeschaltet werden. Für welche Güter dies in welchem Umfang geschehen soll, ist wiederum eine ordnungspolitische Entscheidung[449].
2. Konvergenz ökonomischer und strafrechtlicher Verhaltensordnung
202
Da das Strafrecht im Wesentlichen (nur) die Voraussetzungen für das Verhängen einer Sanktion als Reaktion auf ein Fehlverhalten festlegt, ist es bereits seiner Natur nach auf die Rezeption der Rechtsordnung als sozialer Handlungsordnung angelegt. Formal werden die Verhaltensnormen insbesondere über Verletzungs- und Gefährdungsdelikte rezipiert; material betont die Strafe, verstanden als Kosten einer Normübertretung, die Bedeutung der entsprechenden Verhaltensnormen. Beide Gedanken sollen hier nochmals kurz – jetzt allerdings mit besonderem Bezug zur Rechtsordnung als sozialer Handlungsordnung für das Wirtschaftsstrafrecht – wiederholt werden.
a) Formale Gewährleistung konvergenter Verhaltensordnungen durch Verletzungs- und Gefährdungsdelikte sowie verwaltungsakzessorische Tatbestände
203
Indem der Gesetzgeber zum Schutz eines bestimmten Interesses ein Verletzungsdelikt normiert, schafft er – anders als bei den Gefährdungsdelikten – eine Art Generalklausel, die die rechtlich missbilligte Verletzung dieses Interesses mit einer Sanktion belegt[450].
Das Auferlegen einer Sanktion verlangt dem Gesetzgeber allerdings in formeller Hinsicht besondere Anstrengungen ab. So dürfen wegen des Vorbehalts des Gesetzes strafrechtliche Sanktionen grundsätzlich nur auf der Grundlage von Parlamentsgesetzen verhängt werden[451] und die Normen müssen, um eine hinreichende handlungsleitende Wirkung entfalten zu können, hinreichend bestimmt sein. Art. 103 Abs. 2 GG fasst diese beiden Punkte in dem Grundsatz zusammen, dass eine Tat nur dann bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit vor ihrer Begehung gesetzlich bestimmt war. Damit wird die Orientierungssicherheit des Bürgers im Recht betont und eine mögliche Einbuße an Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit hingenommen; für das Wirtschaftsstrafrecht hat dies zur Folge, dass gerade die sanktionierten Grenzen des rechtlich zugestandenen Verhaltenskorridors besonders präzise bestimmt sind. Die Anforderungen an den Bestimmtheitsgrundsatz werden heute gleichwohl je nach der Grundrechtsrelevanz und je nach Lebensbereich unterschiedlich streng durchgesetzt[452].
Das Postulat der Bestimmtheit einer strafrechtlichen Norm wird im Rahmen der Erfolgsdelikte trotz der generellen Bezugnahme auf beliebiges Verhalten in der strafrechtlichen Diskussion als weitgehend erfüllt betrachtet. Indem der strafrechtlich relevante Verletzungserfolg tatbestandlich umschrieben ist, erscheint das strafrechtlich relevante Unrecht hinreichend typisiert[453].
204
Mit den Gefährdungsdelikten werden spezifische Vorgaben für eine ganz bestimmte Handlungssituation sanktionenrechtlich abgesichert.
Vor dem Hintergrund des angesprochenen Bestimmtheitsgebots werfen Gefährdungsdelikte insbesondere dann Probleme auf, wenn diese als Blankettstrafgesetze ausgestaltet sind[454]: Blankettstrafgesetze sind Strafgesetze, in denen zur Konkretisierung des Verbots- oder Gebotstatbestandes auf andere Rechtsakte bzw. technische Normen oder Standards verwiesen wird[455]. Bei einer einfachen Blankettnorm konkretisiert die ergänzende Norm lediglich den Tatbestand eines Strafgesetzes, während bei einer qualifizierten Blankettnorm die ergänzende Norm die Strafbarkeit eines Verhaltens grundsätzlich festlegt oder ausschließt[456]. Im Zusammenspiel von Verhaltens- und Sanktionsordnung ist es die Aufgabe dieser Blankettnormen, den richtigen Umgang insbesondere auch mit sehr heterogen ausgestalteten Arbeits- und Produktionsprozessen zu finden. Blankettstraftatbestände dienen als einfache und flexible normative Oberfläche, mit deren Hilfe das Straftatsystem mit dem Wirtschaftssystem interagieren kann. Gerade im Nebenstrafrecht wurde so für ganze Rechtsgebiete eine ganz exakte strafrechtliche Rahmenordnung etabliert[457]. Dem Bestimmtheitsgrundsatz genügen Blankettstrafgesetze allerdings nur, wenn die Sanktions- und Ausfüllungsnorm hinreichend klar miteinander verknüpft sind und sich der Kern des strafbaren Verhaltens bereits aus dem Wortlaut des Blankettstrafgesetzes ergibt[458].
Eine individuelle Spezifizierung der Verhaltensordnung erfolgt über (verwaltungsakt)akzessorisch ausgestaltete Tatbestände, die direkt auf für einen konkreten Einzelfall bezogene Rechtsakte der Verwaltung Bezug nehmen[459]. Die Gesetzgebung setzt diese Technik insbesondere in zwei Bereichen ein: Zum einen dort, wo die normativen Vorgaben auf der Ebene der Spezialgesetze und sie konkretisierender Rechtssätze insgesamt noch zu lückenhaft oder konkretisierungsbedürftig sind, um eine hinreichende Verhaltenssteuerung gewährleisten zu können[460]. Zum anderen dort, wo der Realbereich einem solchen Wandel und einer solchen Vielfalt von Gegebenheiten unterliegt, dass eine abstrakt generelle Regelung nicht hinreichend bestimmt getroffen werden kann[461]. Der strafrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz steht einer solchen Anknüpfung der Strafdrohung an einen Verstoß gegen einen Verwaltungsakt nicht grundsätzlich entgegen. Notwendig ist allerdings, dass die Voraussetzungen für den Erlass des Verwaltungsaktes hinreichend genau in einem parlamentarischen Gesetz festgelegt sind und der Verwaltungsakt seinerseits einen hinreichend konkreten Inhalt hat[462]. Schwierige Probleme können sich ergeben, wenn sich der Rechtsakt der Verwaltung, an den die Sanktionsnorm anknüpft, als fehlerhaft erweist und nichtig oder rechtswidrig ist und dadurch den Adressaten übervorteilt oder benachteiligt[463].
Читать дальше