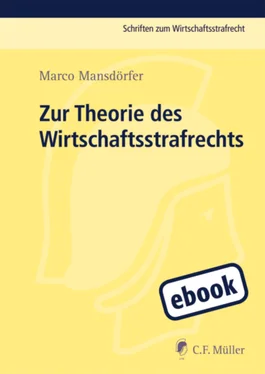213
Der Umstand, dass Unternehmen in einer bestimmten Zeitspanne eine große Anzahl von verschiedenen Zuständen annehmen können, wird in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur zum Teil als Komplexität bezeichnet[477]. Indem wirtschaftsstrafrechtliche Normen einige dieser Zustände als unerwünscht ausscheiden, bewirken sie normativ eine Komplexitätsreduktion. Eine solche Reduktion von Komplexität verlangt den fremdgestaltenden Eingriff des Managements[478], dessen zentrale Aufgabe gerade die Führung und Steuerung des Unternehmens ist. Die Eingriffsverpflichtung der Unternehmensleitung erstreckt sich sowohl auf unternehmensinterne Vorgänge wie auf außenwirksame Unternehmensaktivitäten, auf eigentümergeleitete wie auf managergeleitete Unternehmungen[479]. Die Konvergenz der rein wirtschaftlichen Funktion mit der strafrechtlichen Verantwortung kommt dann in einem zur konkreten Funktion synchronen Verständnis der Zurechnungsformen strafrechtlicher Pflichtenbegründung und Beteiligungsformen zum Ausdruck[480]. Hier liegt also der Ansatz zur materialen Gewährleistung konvergenter Verhaltensordnungen, die im Wirtschaftsstrafrecht bislang freilich noch nicht konzeptionell erfasst worden ist. Konkret fehlt es etwa insbesondere für die Begründung der Verantwortlichkeit des Managements an einer Diskussion der der Tätigkeit des Managements und seiner Funktion angemessenen Verantwortlichkeits- und Zurechnungsstrukturen[481].
b) Möglichkeiten und Instrumente zur Aufgabenrealisierung
214
Ein wichtiger Hinweis, in welchem Maß ein erwünschtes Verhalten überhaupt durch externe Steuerungsinstrumente befördert werden muss, lässt sich bis zu einem gewissen Grad aus entscheidungs- und spieltheoretischen Erwägungen ableiten[482]. Die Norm als abstrakt-generelles Regelungsinstrument kann gerade unter der Prämisse sinnvoll eingesetzt werden, dass die intrinsische Motivation des Normadressaten der Zwecksetzung der Norm grundsätzlich gegenläufig ist. Gesetzgebung ist dann Reaktion auf einen – tatsächlichen oder unterstellten – Zielkonflikt privater und öffentlicher bzw. individueller und genereller Interessen.
215
Die betriebswirtschaftliche Lehre zur (strategischen) Unternehmensführung versucht, Zielkonflikte durch eine hierarchische Ordnung der Einzelziele zu lösen. Der Wirtschaftsteilnehmer muss für sein Handeln danach zunächst ein Oberziel, das sog. Unternehmensleitbild[483], formulieren[484]. Angesprochen ist damit ein Katalog von Kriterien, der das grundsätzliche Verhalten des Unternehmens gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Aktionären, Staat und Gesellschaft, die Grundzüge der Akquisitions-, Beteiligungs- und Kooperationspolitik des Unternehmens sowie die Einstellung des Unternehmens zu Wachstum, technischem Fortschritt, Ressourcenverwendung und natürlicher Umwelt festlegt[485]. Konkretisiert wird dieses Unternehmensleitbild, indem Unterziele formuliert werden, die sich bezüglich ihres Inhalts und ihrer Adressaten im Unternehmen präzisieren lassen.
216
Für die private Unternehmung als marktwirtschaftlich orientiertem Betrieb ist das oberste Ziel[486] in der Theorie wie in der Praxis die langfristige Gewinnmaximierung[487]; für öffentliche Unternehmen ist das oberste Ziel in der Regel die Versorgung der Bevölkerung mit bestimmten Leistungen unter Wahrung des Kostendeckungsprinzips[488]. Während diese Ziele in der Theorie isoliert von einem idealen Unternehmen mit vollkommener Voraussicht bei vollkommener Markttransparenz, unendlicher Reaktionsgeschwindigkeit und minimalen Transaktionskosten verfolgt werden können, sind in der Praxis eine Reihe weiterer Nebenbedingungen zu beachten, die dann in der Zielfunktion ihren Niederschlag finden. Das Unternehmensleitbild wandelt sich so zu einem Zielsystem, das als Kompromiss zwischen den beteiligten Instanzen (mit konkurrierenden Zielvorstellungen) verstanden werden kann[489]. Im Rahmen dieses Zielbildungsprozesses lassen sich auf diese Weise auch nicht-monetäre Zielvorstellungen ökonomischer und außerökonomischer Art in das Unternehmensleitbild als Teil eines Zielbündels integrieren.
217
Die Einzelziele lassen sich nach dem angestrebten Ausmaß der Zielerreichung, der Beziehung zwischen den Zielen und dem zeitlichen Bezug der Ziele systematisieren. Während das Oberziel (in der Regel die Gewinnmaximierung) nicht operational in messbaren Größen formuliert werden kann, enthalten die konkretisierten Unterziele – insbesondere für die einzelnen Unternehmensbereiche – operational messbare Vorgaben. Bei jeder Entscheidungsinstanz bleibt allerdings auch nach der Delegation von Aufgaben ein Rest von Entscheidungsgewalt. Gerade weil in funktionalen Organisationsstrukturen die nachgeordnete Instanz nur ein Teil- oder Zwischenziel gesetzt erhält, verliert sie leicht[490] die Verbindung zum Oberziel. Genau aus diesem Grund wird in der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre gefordert, jede Ebene müsse die ihr nachgeordnete Abteilung und die Einhaltung der eigenen Ziele überwachen.
218
Die von der Rechtsordnung verbindlich festgelegten – und dann in konsequenter Fortführung dieser Verbindlichkeit auch durch Sanktionen flankierten – Vorgaben lassen sich zeitlich in kurz-, mittel- und langfristige Zielvorgaben aufteilen. Zum rein ökonomischen Oberziel (der Gewinnmaximierung/Versorgung der Bevölkerung mit bestimmten Gütern) stehen diese Ziele in Konkurrenz und können im Extremfall sogar antinomisch wirken, indem einzelne wirtschaftliche Betätigungen vollständig ausgeschlossen werden. Die unternehmensethischen Zielvorgaben und die von der Rechtsordnung festgelegten Vorgaben müssen in ihrer Zielrichtung dagegen konform sein und einander wechselseitig unterstützen. Integrative Unternehmensethik und die ordnungsrechtlichen Vorgaben bilden auf diese Weise die normative Grundlage für ein Konzept der „organisierten Verantwortlichkeit“ in einer Unternehmung[491].
219
Organisatorisch umgesetzt werden diese Zielvorgaben, indem auf die Erkenntnisse der Entscheidungs-, Handlungs- und Organisationstheorie zurückgegriffen wird und entsprechende soziale Mechanismen implementiert werden[492]. Die wirtschaftsethischen Zielvorgaben sind dazu konsequent in sämtliche Führungssysteme zu internalisieren[493]. Rechtsethische Zielsetzungen und die verbindlichen und durch Sanktionen flankierten Normen des Wirtschaftsrechts prägen den kautelarjuristischen Rahmen für die Ausgestaltung von Verhaltensgrundsätzen und Führungsrichtlinien, Leistungsbeurteilungs-, Honorierungs- und Beförderungssystemen.
4. Grenzen normativer Steuerung und Übererfüllung normativer Mindesterwartungen
a) Grenzen normativer Steuerung
220
Mit den vorstehenden Erwägungen sind zugleich die Grenzen der normativen Steuerung der Wirtschaftsprozesse beschrieben: Die sanktionenrechtlich flankierte hoheitliche Rahmenordnung muss ihre Zielvorgaben insgesamt offen gestalten in Bezug auf die Mittel zum Einhalten der ordnungspolitisch gesetzten Rahmen (sog. Rechtscompliance), flexibel sein in Bezug auf unterschiedliche Ablauf- und Verfahrensgestaltungen[494] und neutral sein gegenüber allen unternehmensstrategischen Entscheidungen.
221
Gerade in Bezug auf die Gestaltung der Verfahren zum individuellen Wirtschaften, in Bezug auf die Ausgestaltung der konkreten Abläufe in einem Unternehmen und in Bezug auf die jeweils verfolgte Unternehmensstrategie kann eine staatliche Steuerung allenfalls durch weiche, genuin öffentlich-rechtliche Anreizsysteme, nicht dagegen durch rein punitiv wirkende Sanktionen erfolgen. Traditionelle Beispiele für derartige Anreizsysteme sind die Gewährung von Subventionen, steuerliche Erleichterungen oder die Berücksichtigung der sozialen Wertschöpfungsbilanz einer Unternehmung bei der öffentlichen Auftragsvergabe. In der jüngeren Diskussion kommt hierzu noch die Ausgestaltung des Finanzmarkts, wie etwa die Abhängigkeit von Unternehmungen von einem stärker volatilen Aktienmarkt oder die Möglichkeit der Refinanzierung durch klassisches Fremdkapital (insbesondere Kredite oder Anleihen). Staatliche bzw. bezugsgruppenorientierte Steuerung erfolgt also durch die Vorgabe und Ausgestaltung der Rahmenbedingungen einer staatlichen Präferenzordnung in Bezug auf ökonomische Ziele.
Читать дальше