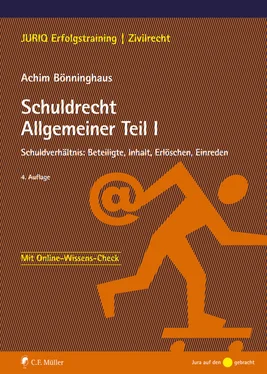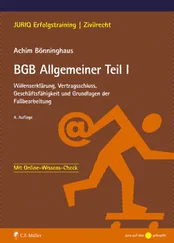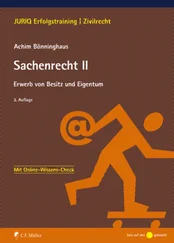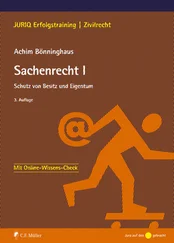Im Zweifel folgt aus § 269, dass nicht nur der Leistungs-, sondern auch der Erfolgsort am Sitz des Schuldners liegt. Das Gesetz geht im Zweifel also von einer Holschuld aus.[11]
159
Bei der „Bringschuld“ fallen Leistungs- und Erfolgsort ebenfalls zusammen. Diese liegen hier aber am Sitz des Gläubigers.[12] Der Schuldner kann sich hier nicht mit der Aussonderung des Leistungsgegenstandes begnügen, sondern muss nun auch den Transport zum Gläubiger übernehmen und dort alles tun, was seinerseits zur Herbeiführung des Leistungserfolges notwendig ist.[13]
160
Bei der „Schickschuld“ fallen Leistungs- und Erfolgsort auseinander. Der Leistungs(handlungs)ort liegt am Sitz des Schuldners, während sich der Erfolgsort am Sitz des Gläubigers befindet.[14] Die erforderliche Leistungs handlungerschöpft sich hier in der Übergabe des mangelfreien Leistungsgegenstandes an eine geeignete Transportperson und ihre Beauftragung mit dem Transport an die Zieladresse des Gläubigers (vgl. § 447).[15] Den Transport schuldet der Schuldner hier nicht.
Hinweis
Die Transportpersonist deshalb bei der Schickschuld kein Erfüllungsgehilfedes Schuldners i.S.d. § 278, weil der Transport nicht mehr zur Leistungshandlung des Schuldners gehört! [16]
Aus § 269 Abs. 3 folgt, dass allein die Verpflichtung zur Versendung und die Übernahme von Versandkosten noch keine ausreichende Vermutung für eine Bringschuld begründet.
Beispiel
Wer sich als Verkäufer zur Versendung des Kaufgegenstandes verpflichtet und die Versandkosten zu tragen bereit ist, vereinbart mit dem Schuldner im Zweifel noch keine Bringschuld, sondern nur eine Schickschuld i.S.d. § 447. Dies gilt nach wohl h.M. auch im reinen Versandhandel, da § 269 Abs. 3 insoweit keine Unterschiede macht und im Zweifel anzunehmen ist, der Verkäufer wolle nur die weniger einschneidenden Leistungspflichten der Schickschuld übernehmen.[17] Zur Frage der Gefahrtragung beim Verbrauchsgüterkaufvertrag beachte aber die Sonderregel des § 475 Abs. 2 (bitte lesen).
3. Sonderfall: Geldschulden
161
Besteht die Verpflichtung des Schuldners in der Zahlung einer Geldsumme, besteht der geschuldete Erfolg darin, dem Gläubiger den geschuldeten Geldbetrag endgültig zur freien Verfügung zu verschaffen.[18]
Das Gesetz geht regelmäßig von der Erfüllung einer Geldschuld durch Übereignung von Barmitteln aus.[19]
Bei einer Banküberweisung wird der zur Erfüllung erforderliche Leistungserfolg dann erzielt, wenn der Gläubiger den geschuldeten Geldbetrag endgültig zur freien Verfügung erhält und dann im Ergebnis so gestellt wird, wie er bei Erhalt von Barmitteln stehen würde.[20] Dies ist dann der Fall, wenn der überwiesene Betrag dem Konto des Gläubigers gutgeschrieben wird.[21]
Hinweis
Für den Fall einer Zahlung durch Überweisung gelten folgende Grundsätze:
| 1. |
Die Zulässigkeit einer Überweisung zum Zwecke der Erfüllung einer Geldschuld setzt das Einverständnis des Gläubigers voraus. Dieses kann stillschweigend erteilt werden und liegt i.d.R. in der Bekanntgabe des Girokontos auf Briefen, Rechnungen und dergleichen an den Schuldner, nicht aber in der bloßen Tatsache der Eröffnung und des Führens eines solchen Kontos.[22] |
| 2. |
Die Überweisung auf ein anderes als das angegebene Konto hat keine Erfüllungswirkung.[23] |
| 3. |
Die Erfüllung tritt mit der Gutschrift auf dem Empfängerkonto ein.[24] |
162
Nach § 270 ist der Schuldner eines Geldbetrages verpflichtet, den Betrag auf eigenes Risiko an den Gläubiger zu übermitteln. Dies scheint der Sache nach eine Bringschuld zu begründen, da ja der Erfolgsort zwingend beim Gläubiger liegt und der Schuldner außerdem das Übermittlungsrisiko tragen soll. Jedoch ergibt sich aus § 270 Abs. 4, dass die Vorschrift an der in § 269 bestimmten Verteilung von Leistungs- und Erfolgsort nichts ändern möchte. Leistungsort ist bei einer Geldschuld also gemäß § 269 im Zweifel ebenfalls der Wohnsitz des Schuldners bzw. der Sitz seiner gewerblichen Niederlassung. Die Bedeutung des § 270 Abs. 1 besteht lediglich darin, dass der Schuldner abweichend vom Grundmodell der §§ 275 Abs. 1, 243 Abs. 2 nach § 270 Abs. 1 auch die Gefahr des zufälligen Untergangs bei der Übermittlung des Geldes trägt. Man spricht bei der Geldschuld deshalb auch von einer „qualifizierten Schickschuld“.[25]
Hinweis
Bei Zahlung durch (vom Gläubiger gebilligte!) Überweisung besteht die Leistungshandlung des Schuldners darin, einen Zahlungsdienstvertrag (§ 675f) mit seiner Bank zu schließen und für die Kontodeckung zu sorgen.[26]
Die vertragliche Situation einer Überweisung stellt sich wie folgt dar: Der Überweisende schließt mit seiner Bank einen Zahlungsdienstvertrag als Sonderfall eines Geschäftsbesorgungsvertrages i.S.d. §§ 675c ff. über den beabsichtigten Zahlungsvorgang(vgl. Legaldefinition in § 675f Abs. 4) ab. In der Folge schreibt die Bank des Empfängers den überwiesenen Betrag dem Konto des Empfängers im Rahmen des mit diesem abgeschlossenen „Zahlungsdiensterahmenvertrages“ (§ 675f Abs. 2) gut. Dazu ist sie gemäß § 675t Abs. 1 unverzüglich nach der bei ihr erfolgten Gutschrift verpflichtet (Anspruch des Empfängers aufdie Gutschrift). Erst aus der erfolgten Gutschrift entsteht schließlich ein Anspruch des Empfängers gegen seine Bank aus einem abstrakten Schuldversprechen gemäß §§ 780, 781 (Anspruch ausder – erfolgten – Gutschrift).
Die Gutschrift (also das Schuldanerkenntnis) wird wirksam, sobald die Bank durch einen Organisationsakt die Daten der Gutschrift auf dem Konto dem Kunden zugänglich macht.[27] Dies kann durch vorbehaltlose Absendung bzw. Bereitstellung der Kontoauszüge oder dadurch geschehen, dass dem Kunden der ihn betreffende Datenbestand durch die Bank, z.B. über einen Kontoauszugsdrucker, vorbehaltlos zur Verfügung gestellt wird.[28] Da die Bank Kaufmann ist, ist dieses Schuldanerkenntnis entgegen §§ 780, 781 gem. § 350 HGB formlos, d.h. auch ohne Unterschrift, vgl. § 126, gültig.
3. Teil Erfüllung nach § 362› C. Bewirken der geschuldeten Leistung› III. Leistungszeit
163
Erfüllung setzt weiter voraus, dass die Forderung in zeitlicher Hinsicht überhaupt erfüllbar ist.[29] Dabei ist begrifflich genau zwischen der „Erfüllbarkeit“ einerseits und der „Fälligkeit“ andererseits zu unterscheiden.

Unter Fälligkeit der Leistungist allgemein der Zeitpunkt zu verstehen, von dem an der Gläubiger die Leistung verlangen kann.[30]
Eine betagteForderung ist eine Forderung, die zwar schon entstanden, aber noch nicht fällig ist.[31]
Erfüllbarkeitmeint den Zeitpunkt, ab dem der Schuldner leisten darfund der Gläubiger bei Nichtannahme in Annahmeverzug gem. §§ 293 ff. gerät.[32]
164
Der Zeitpunkt der Erfüllbarkeit richtet sich – wie sonst auch – in erster Linie nach Vereinbarungen der Parteien und den sonstigen Umständen des Schuldverhältnisses.
165
Haben sich die Parteien bei Vertragsschluss auf einen Termin verständigt, ist nach der Auslegungsregel des § 271 Abs. 2 im Zweifel anzunehmen, dass der Gläubiger die Leistung nicht vor dieser Zeit verlangen, der Schuldner sie aber vor dieser Zeit bewirken kann. Damit erhält die Auslegungsregel des § 271 Abs. 2 dem Schuldner im Zweifel die Möglichkeit, den Anspruch freiwillig vorher zu erfüllen, indem der Anspruch im Zweifel sofort und vor dem vereinbarten Termin erfüllbar ist.
Читать дальше