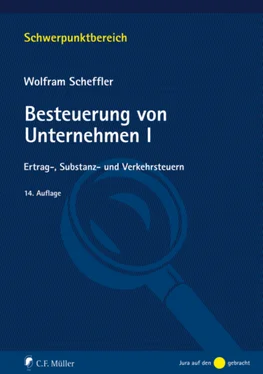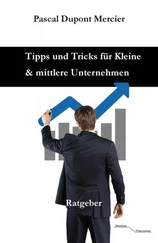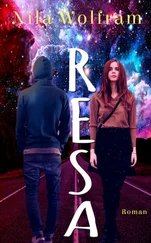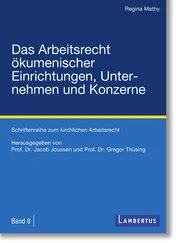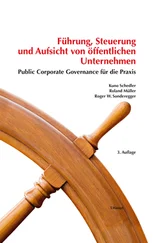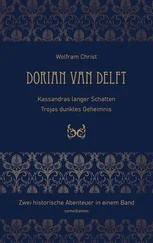Einfuhr- und Ausfuhrabgabennach Art. 5 Nr 20, 21 des Zollkodexes der Europäischen Union (Unionszollkodex) sind gleichfalls als Steuern anzusehen (§ 3 Abs. 3 AO). Zölle dienen der Warenstromregulierung. Im Vordergrund steht der wirtschaftspolitische Lenkungszweck. Die Erzielung von Einnahmen ist lediglich Nebenzweck. Zölle sind Abgaben, die der Staat nach den Vorgaben des Unionszollkodexes bei Warenbewegungen über die Staatsgrenze (Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr) erhebt. Bei Warenbewegungen zwischen den Mitgliedstaaten der EU sind Zölle allerdings bereits seit langem abgeschafft worden.
Abb. 1.1:
Öffentlich-rechtliche Lasten

[Bild vergrößern]
4
Zwangsgelder, Säumniszuschläge (verspätete Zahlung von Steuern), Verspätungszuschläge (verspätete Abgabe einer Steuererklärung), Verzögerungsgelder, Verspätungsgelder, die Zuschläge nach § 162 Abs. 4 AO (bei Verletzung von Mitwirkungspflichten, die speziell für international tätige Unternehmen bestehen), Zinsen und Kosten sind keine Steuern. Sie werden aber zum Teil als steuerliche Nebenleistungenverfahrenstechnisch wie Steuern behandelt (§ 3 Abs. 4 iVm § 37 Abs. 1 AO).
5
Steuern sind nur eine – wenngleich die wichtigste – Form von öffentlichen Abgaben, mit denen die öffentliche Hand aufgrund ihres Hoheitsrechts Einnahmen erzielt. Weitere Finanzabgaben an öffentlich-rechtliche Institutionen sind Gebühren, Beiträgeund Sonderabgaben.
6
Gebühren und Beiträge unterscheiden sich hinsichtlich der Art der Gegenleistung. Gebührensind Zahlungen für besondere Leistungen einer öffentlichen Körperschaft oder für die (freiwillige oder erzwungene) tatsächliche Inanspruchnahmevon öffentlichen Einrichtungen. Sie unterteilen sich in Verwaltungsgebühren(zB Ausstellung eines Ausweises oder Passes, Beurkundungen, Erteilung von Bescheinigungen, Genehmigungen, Bauabnahmen oder Einbürgerungen, Pfändungsgebühren, Kosten für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach § 89 AO, Kosten bei besonderer Inanspruchnahme der Zollbehörden nach § 178 AO, Kosten für die Durchführung eines Verständigungsverfahrens mit einer ausländischen Finanzbehörde nach § 178a AO) und Nutzungsgebühren(zB Benutzung von Sportanlagen, Krankenhäusern, Friedhöfen, Büchereien, Schlachthöfen, Nutzung von Verkehrseinrichtungen, wie Häfen, Flughäfen oder öffentlichen Parkplätzen, Inanspruchnahme von öffentlichen Versorgungseinrichtungen für Wasser, Strom oder Gas oder für die Entsorgung, wie Abwasser- und Kanalgebühren).
7
Beiträgestellen Aufwandsersatz für die mögliche Inanspruchnahmeeiner konkreten Leistung einer öffentlichen Einrichtung dar. Auf den konkreten Vorteil für den betreffenden Beitragszahler kommt es im Gegensatz zu Gebühren nicht an. Für die Erhebung eines Beitrags reicht die bloße Möglichkeit der Inanspruchnahme der Leistung aus. Beispiele für Beiträge sind Straßenanliegerbeiträge und Kurtaxen. Besondere Gruppen bilden die Verbandslasten zur Finanzierung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft durch ihre Mitglieder (Beiträge an die Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer oder Steuerberaterkammer) sowie die Beiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen(Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung). In einer weiten Abgrenzung des Steuerbegriffs können die „Beiträge“ zu den gesetzlichen Sozialversicherungen auch unter den Begriff der Steuern subsumiert werden.
8
Sonderabgabe(außersteuerliche Abgabe) ist ein Oberbegrifffür ein breites Spektrum öffentlicher Abgaben eigener Art.[3] Die mit diesen parafiskalischen Abgaben verbundenen Zielsetzungen sind so unterschiedlich, dass sich keine allgemeine Definition formulieren lässt. Von Steuern unterscheiden sich Sonderabgaben dadurch,
| – |
dass ihr Aufkommen nicht in den allgemeinen Staatshaushalt eingeht, sondern in einen Sonderfonds, aus dem die vorgegebenen Ziele finanziert werden, und |
| – |
dass sie nur von einer bestimmten Gruppevon Bürgern erhobenwerden. |
Sonderabgaben sind umstritten, weil die Gefahr besteht, dass durch die Anerkennung einer Abgabenkompetenz außerhalb der Finanzverfassung des Grundgesetzes die Abgabenbelastung unüberschaubar wird. Des Weiteren durchbricht die Parafiskalität der Sonderabgaben den Verfassungsgrundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplans und entzieht die Verwendung des Abgabenaufkommens der parlamentarischen Kontrolle. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts[4] sind Sonderabgaben deshalb nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen zulässig: Sonderabgaben dürfen nur dann erhoben werden, wenn der verfolgte Zweck in einer besonderen Verantwortung der belasteten Gruppe liegt (Sachverantwortung) und nicht in die Gesamtverantwortung des Staates fällt. Sie müssen die Kriterien Homogenität der Abgabepflichtigen(gemeinsame Interessenlage, von anderen Gruppen abgrenzbar), Gruppenverantwortungsowie Gruppennützigkeit(das Aufkommen ist im Interesse der Abgabenpflichtigen zu verwenden) erfüllen. Beispiele für Sonderabgaben, bei denen eher der Finanzierungszweck im Vordergrund steht, sind Beiträge für den Restrukturierungsfonds (Finanzierung künftiger Restrukturierungs- und Abwicklungsmaßnahmen bei systemrelevanten Banken), die Filmabgabe, die Hebammenabgabe, die Abgabe in Weinbaufonds, die Milchausgleichsabgabe und die Naturschutzabgabe. Eine Sonderabgabe mit Lenkungsaufgabe ist beispielsweise die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.
Die Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Sonderabgaben folgt dem Äquivalenzprinzip. Danach steht die spezielle Entgeltlichkeit der Abgabe im Vordergrund, dh der Grundsatz von Leistung und Gegenleistung. Die Erhebung von Steuern folgt hingegen dem Leistungsfähigkeitsprinzip, dh die Belastung richtet sich nach der Fähigkeit des Steuerpflichtigen, zur Finanzierung der staatlichen Ausgaben beizutragen.
Erster Teil Einführung› Erster Abschnitt Wichtige Begriffe › B. Steuerarten
9
Das Steuersystemumfasst die Gesamtheit derin einem Staat erhobenen Einzelsteuern. Das Steuersystem der Bundesrepublik setzt sich aus ca. 40 Steuerartenzusammen.[5] Ihr Aufkommenbetrug im Jahr 2017 rund 734,5 Mrd. €. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt von 3 277,3 Mrd. € errechnet sich eine Steuerquote von 22,4%.[6] Vom Gesamtsteueraufkommen entfallen auf die fünf bedeutsamsten Einzelsteuern etwa 85%: Einkommensteuer (283,2 Mrd. €), Umsatzsteuer (226,4 Mrd. €), Gewerbesteuer (52,8 Mrd. €), Energiesteuer (41,0 Mrd. €) und Körperschaftsteuer (29,3 Mrd. €). Nur weitere fünfzehn Steuerarten haben ein Aufkommen von mehr als 0,5 Mrd. €. Die anderen Einzelsteuern, insbesondere örtliche Verbrauch- und Verkehrsteuern, werden wegen ihrer geringen fiskalischen Bedeutung auch als Bagatellsteuernbezeichnet.
Die folgende Übersicht zeigt das Steueraufkommen der 20 wichtigsten Steuerarten im Jahr 2017:[7]
Abb. 1.2: Steueraufkommen der 20 wichtigsten Steuerarten im Jahr 2017
| Steuerart |
in Mrd. € |
in% des Steueraufkommens |
Steuerart |
in Mrd. € |
in% des Steueraufkommens |
| Einkommensteuer |
283,2 |
38,6 |
Stromsteuer |
6,9 |
0,9 |
| Umsatzsteuer |
226,4 |
30,8 |
Erbschaft- und |
6,1 |
0,8 |
| Gewerbesteuer |
52,8 |
7,2 |
Schenkungsteuer |
|
|
| Energiesteuer |
41,0 |
5,6 |
Zölle |
5,1 |
0,7 |
| Körperschaftsteuer |
29,3 |
4,0 |
Alkoholsteuer |
2,1 |
0,3 |
| Solidaritätszuschlag |
18,0 |
2,5 |
Rennwett- und |
1,8 |
0,2 |
| Tabaksteuer |
14,4 |
2,0 |
Lotteriesteuer |
|
|
| Grundsteuer |
14,0 |
1,9 |
Kaffeesteuer |
1,1 |
0,1 |
| Versicherungsteuer |
13,3 |
1,8 |
Luftverkehrsteuer |
1,1 |
0,1 |
| Grunderwerbsteuer |
13,1 |
1,8 |
Biersteuer |
0,7 |
0,1 |
| Kraftfahrzeugsteuer |
8,9 |
1,2 |
Feuerschutzsteuer |
0,5 |
0,1 |
In der Literatur finden sich zahlreiche Gliederungen und Systematisierungen der Steuerarten, von denen zwei von besonderer Bedeutung sind:
Читать дальше