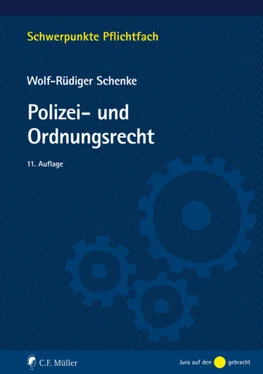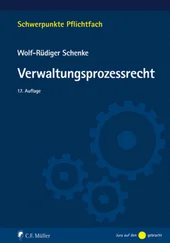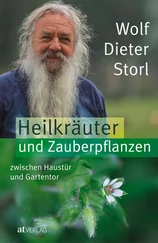11
Zur Aufgabe der Gefahrenabwehr gehört auch die Gefahrenvorsorge[7]. Dabei wird der Staat bereits im Vorfeld einer konkreten Gefahr[8] aktiv, die zwar zum Zeitpunkt des Handelns noch nicht vorliegt, die aber später entstehen kann. Durch das staatliche Handeln soll in diesem Fall entweder das spätere Entstehen einer Gefahr verhindert oder zumindest deren wirksame Bekämpfung ermöglicht werden (s. dazu Rn 76). Die Gefahrenvorsorge umfasst auch die Verhütung von Straftaten, bei der noch keine konkrete Gefahr vorzuliegen braucht[9]. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Bekämpfung konkreter Gefahren und wird traditionell ebenfalls der Aufgabe der Gefahrenabwehr zugerechnet. Die allgemeine Gefahrenvorsorge unterfällt damit der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länderfür das allgemeine Polizei- und Ordnungsrecht[10]. Allerdings können daraus, dass die Gefahrenvorsorge zur Aufgabe der Gefahrenabwehr gehört, keine Eingriffsrechte der Polizei- bzw Ordnungsbehörden abgeleitet werden. Ein Eingriff auf Grund der polizei- und ordnungsrechtlichen Ermächtigungsnormen erfordert vielmehr idR (zumindest) das Vorliegen einer konkreten Gefahr (s. unten Rn 75). Soweit der Gesetzgeber ausdrücklich Eingriffsbefugnisse anordnet, die schon im Vorfeld einer konkreten Gefahr, also im Bereich der Gefahrenvorsorge, liegen (s. dazu iVm der Schleierfahndung Rn 133 f; iVm der Videoüberwachung Rn 204), müssen diese Regelungen anhand des Übermaßverbots (dazu Rn 412) streng überprüft werden. Sie sind allerdings – wie das BVerfG [11] zu Recht annimmt – nicht schon deswegen verfassungsrechtlich unzulässig, weil sie für ein polizeiliches Tätigwerden geringere Anforderungen stellen, als dies traditionell sonst bei der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung der Fall ist. Ein polizeiliches Tätigwerden erfordert dort sonst grundsätzlich eine konkrete Gefahr (Gefahrenabwehr) bzw einen Anfangsverdacht (Strafverfolgung).
Durch eine Vielzahl neuerer Gesetze mit kriminalpräventivem Charakter, die eine Handlung bereits dann unter Strafe stellen, wenn sie in (weitere) Straftaten des Handelnden und/oder Dritten einzumünden droht, hat sich freilich die Grenze zwischen der Gefahrenvorsorgeund der Abwehr konkreter Gefahrenzugunsten Letzterer verschoben. Polizeiliche Eingriffsmaßnahmen kommen damit bereits dann in Betracht, wenn die Verwirklichung des Tatbestands einer kriminalpräventiven Norm konkret droht. Damit erweitern sich die polizeilichen Handlungsbefugnissebereits ohne Änderung polizeilicher Normen erheblich[12].
c) Keine Einbeziehung der Strafverfolgungsvorsorge
12
Nicht zur Gefahrenabwehr zählt die Strafverfolgungsvorsorge, die der zukünftigen Verfolgung möglicher späterer bzw später bekannt werdender Straftaten dient. Sie ist der Strafverfolgung zuzurechnenund unterfällt damit als Annex der Kompetenz des Bundes für das gerichtliche Verfahren gem. Art. 74 I Nr 1 GG (s. näher Rn 30). Ob eine konkrete Maßnahme der Strafverfolgungsvorsorge oder der Gefahrenvorsorge zuzuordnen ist, richtet sich nach ihrer Zielrichtung[13]. Im Einzelfall kann ein polizeiliches Handeln allerdings sowohl der Strafverfolgungsvorsorge wie auch der Gefahrenvorsorgezuzuordnen sein[14]. Deshalb kann etwa die Identitätsfeststellung ( Rn 132f) oder die Videoüberwachung ( Rn 202f) sowohl durch den Landesgesetzgeber (zum Zwecke der Gefahrenvorsorge) als auch durch den Bundesgesetzgeber (zum Zwecke der Strafverfolgungsvorsorge) geregelt werden (s. Rn 30) – je nach der Zielsetzung der Maßnahme. Die Polizei kann deswegen entsprechende Maßnahmen auf beide Rechtsgrundlagen stützen. Es spielt dann keine Rolle, wo der „Schwerpunkt“ ihres Handelns liegt (dazu Rn 476)[15].
13
Der Bundesgesetzgeber hat die Strafverfolgungsvorsorge bisher nicht abschließend und flächendeckend, sondern nur punktuell geregelt, so zB in § 81b Alt. 2 StPO (erkennungsdienstliche Maßnahmen; dazu unten Rn 139) und in § 81g StPO (DNA-Feststellung, so genannter „genetischer Fingerabdruck“; dazu Rn 138)[16]. Solange das Bundesrecht nur solche punktuellen Regelungen enthält, kann der Landesgesetzgebergem. Art. 72 GG die Lücken des Bundesrechts auf dem Gebiet der Strafverfolgungsvorsorge ausfüllen(dazu auch Rn 30). Seine Regelungen kann der Landesgesetzgeber – anknüpfend an § 1 I 2 MEPolG[17] – in sein jeweiliges Polizeigesetz aufnehmen, da die entsprechenden Befugnisse der Polizei zugeordnet sind. Teilweise werden dabei in Anlehnung an § 1 I 2 MEPolG sowohl die Verhütung von Straftaten als auch die Vorsorge für die Verfolgung künftiger Straftaten mit dem einheitlichen Begriff der vorbeugenden Bekämpfung von Straftatenumschrieben[18]. Dies ist wenig glücklich, weil damit verwischt wird, dass zwischen der Strafverfolgungsvorsorge einerseits und der Abwehr konkreter Gefahren[19] bzw der Gefahrenvorsorge andererseits wesentliche Unterschiedebestehen. Die entsprechenden Normierungen sind zudem teilweise widersprüchlich, weil sie nach ihrem eindeutigen Wortlaut der Polizei die Strafverfolgungsvorsorge nur im Rahmen der Gefahrenabwehrzuweisen. Soweit die StPO abschließende Regelungen der Strafverfolgungsvorsorgebeinhaltet, sind landesrechtliche Regelungen, die eine vorbeugende Bekämpfung von Straftaten vorsehen, verfassungskonform so auszulegen, dass sie sich nur auf die Gefahrenvorsorge beziehen( Rn 30)[20].
14
Dass Verwaltungsbehörden Aufgaben der Gefahrenabwehr zugewiesen werden, schließt es nicht aus, diesen Verwaltungsbehörden (insbesondere durch Spezialgesetze) auch Aufgaben der Wohlfahrtspflege zu übertragen. So enthalten etwa die Landesbauordnungen neben Regelungen zur Gefahrenabwehr auch Normen, die die Wohlfahrtspflegebezwecken, so zB die Normen zur Baugestaltung[21]. Über den Bereich der Gefahrenabwehr hinaus führt zB auch § 5 I Nr 1 BImSchG, der die Abwehr erheblicher Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft zum Gegenstand hat (vgl Rn 79). Eine sozialstaatlich motivierte Ausdehnung der staatlichen Tätigkeit führt ohnehin dazu, dass neue Rechtsgüter geschaffen werden, die durch die Polizei vor möglichen Gefahren geschützt werden müssen, wenn spezialgesetzliche Normen fehlen. So ist zB ein baupolizeiliches Einschreiten möglich, wenn die Regelungen der LBO über die ästhetische Gestaltung eines Bauvorhabens missachtet werden.
Teil I Einführung in das Polizei- und Ordnungsrecht› § 1 Die einzelnen Polizeibegriffe› III. Der Begriff der Polizei im institutionellen (organisatorischen) Sinn
III. Der Begriff der Polizei im institutionellen (organisatorischen) Sinn
15
Der Polizeibegriff im institutionellen oder organisatorischen Sinn knüpft an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe von Behörden – nämlich zu der Polizei– an. Polizei im institutionellen (organisatorischen) Sinn bezeichnet demgemäß diejenigen Stellen, die dem Organisationsbereich der Polizei zuzurechnen sind. Der Umfang der Polizei in diesem Sinn differiert in den einzelnen Bundesländern. Dabei lassen sich zwei Gruppen von Ländernunterscheiden. Die eine Gruppe, bestehend aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, hat das sog. Trennungs- oder Ordnungsbehördensystemeingeführt (s. dazu Rn 506f), in dem die Gefahrenabwehr überwiegend nicht von der Polizei, sondern von den Behörden der allgemeinen Verwaltung wahrgenommen wird[22]. Diese Behörden werden in Hamburg und Niedersachsen Verwaltungsbehörden der Gefahrenabwehr genannt. Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen sprechen von Ordnungsbehörden, Bayern und Sachsen-Anhalt von Sicherheitsbehörden. Hessen bezeichnet sie als Gefahrenabwehrbehörden, Sachsen als Polizeibehörden. Die Zuständigkeit der Polizei beschränkt sich in diesen Ländern grundsätzlich auf die Gefahrenabwehr in Eilfällen, die Mitwirkung bei der Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die Vollzugshilfe sowie die sonstigen gesetzlich genannten Aufgaben (näher Rn 508). Man spricht hier von einer Entpolizeilichung[23]. Hierdurch meinte man, einen Missbrauch der Polizeigewalt, wie er im Dritten Reich insbesondere für die Gestapo typisch war, verhindern zu können. Ob in dieser Verengung des Polizeibegriffs – wie zT behauptet wird – ein bedeutsamer rechtsstaatlicher Fortschritt zu sehen ist, erscheint einigermaßen zweifelhaft[24]. Für das Handeln der allgemeinen Verwaltungsbehörden, die mit Aufgaben der Gefahrenabwehr betraut sind, gelten nämlich im Wesentlichen die allgemeinen polizeirechtlichen Grundsätze, auch wenn diese in eigenständigen rechtlichen Regelungen enthalten sind. Zudem kommt heute angesichts der verfassungsrechtlichen, insbesondere der grundrechtlichen Bindungen der staatlichen Gewalt ohnehin dem Polizeibegriff nicht mehr jene rechtsstaatliche Bedeutung zu, die er in der Vergangenheit besaß. Für eine Verengung des Polizeibegriffs spricht allenfalls, dass insbesondere im Zeichen des sozialen Rechtsstaats die Aufgabe der Gefahrenabwehr vielfach durch andere staatliche Zielsetzungen überlagert wird.
Читать дальше