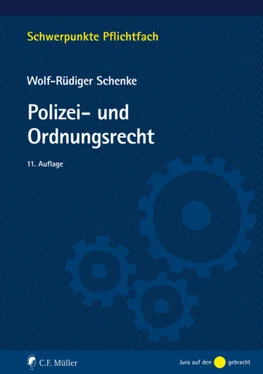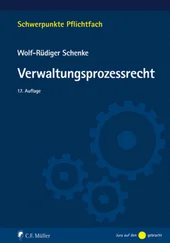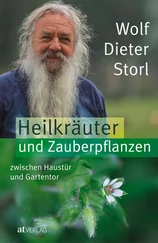| Ebert/Seel |
Thüringer Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei – PAG –, Kommentar, 7. Aufl. 2015. |
| Schwan |
Polizei- und Ordnungsrecht, in: Huber (Hrsg.), Thüringer Staats- und Verwaltungsrecht, 2000, S. 263 ff. |
| Schwan |
Thüringen Ordnungsbehördengesetz, 2. Aufl. 2009. |
| BKAG: Ahlf/Daub/Lersch/Störzer |
Bundeskriminalamtgesetz, 2000. |
| Hufen |
Verwaltungsprozessrecht, 11. Aufl. 2019. |
| Jarass/Pieroth |
Grundgesetz, Kommentar, 16. Aufl. 2020. |
| Knack/Henneke |
Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 10. Aufl. 2014. |
| Kniesel/Vahle |
Polizeiliche Informationsverarbeitung und Datenschutz im künftigen Polizeirecht, Kommentierung zum Vorentwurf zur Änderung des MEPolG, 1990. |
| Koch |
Datenerhebung und -verarbeitung in den Polizeigesetzen der Länder, 1999. |
| Kopp/Ramsauer |
Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 21. Aufl. 2020. |
| Kopp/Schenke |
Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 26. Aufl. 2020. |
| Lorenz D. |
Verwaltungsprozessrecht, 2000. |
| Maurer/Waldhoff |
Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl. 2020. |
| Neuner |
Zulässigkeit und Grenzen polizeilicher Verweisungsmaßnahmen, 2003. |
| Obermayer/Funke-Kaiser |
Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 5. Aufl. 2018. |
| Peine/Siegel |
Allgemeines Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2020. |
| Schenke |
Verwaltungsprozessrecht, 17. Aufl. 2021. |
| Schmitt Glaeser/Horn |
Verwaltungsprozessrecht, 15. Aufl. 2000. |
| Schoch/Schneider/Bier |
Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar (Loseblattsammlung). |
| Schwerdtfeger/Schwerdtfeger |
Öffentliches Recht in der Fallbearbeitung, 14. Aufl. 2012. |
| Stelkens/Bonk/Sachs |
Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 9. Aufl. 2018. |
| Ule/Laubinger |
Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1998. |
| Wolff/Bachof |
Verwaltungsrecht III, 4. Aufl. 1978, §§ 121 ff. |
| Wuttke |
Polizeirecht und Zitiergebot, 2004. |
[1]
Soweit nichts anderes vermerkt ist, wird diese Literatur jeweils nur mit dem Autorennamen zitiert.
[2]
Soweit nichts anderes vermerkt ist, wird diese Literatur jeweils mit dem Autorennamen unter Hinzufügung einer Abkürzung des betreffenden Bundeslandes zitiert.
Teil I Einführung in das Polizei- und Ordnungsrecht
Teil I Einführung in das Polizei- und Ordnungsrecht
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Die einzelnen Polizeibegriffe
§ 2 Das Polizei- und Ordnungsrecht
Teil I Einführung in das Polizei- und Ordnungsrecht› § 1 Die einzelnen Polizeibegriffe
§ 1 Die einzelnen Polizeibegriffe
Inhaltsverzeichnis
I. Die verschiedenen Ansätze zur Bestimmung des Polizeibegriffs
II. Der Begriff der Polizei im materiellen Sinn
III. Der Begriff der Polizei im institutionellen (organisatorischen) Sinn
IV. Der Begriff der Polizei im formellen Sinn
Teil I Einführung in das Polizei- und Ordnungsrecht› § 1 Die einzelnen Polizeibegriffe› I. Die verschiedenen Ansätze zur Bestimmung des Polizeibegriffs
I. Die verschiedenen Ansätze zur Bestimmung des Polizeibegriffs
1
Der Begriff der Polizei kann in unterschiedlicher Bedeutunggebraucht werden, nämlich im materiellen, im institutionellen (organisatorischen) und im formellen Sinn. Maßgebliches Kriterium für den Begriff der Polizei im materiellen Sinn ist die inhaltliche Qualifikation einer staatlichen Tätigkeit, genau gesagt deren Zielsetzung. Ohne Relevanz ist es dabei, welche staatliche Behörde diese Tätigkeit wahrnimmt. Anders hingegen verhält es sich beim Polizeibegriff im institutionellen (organisatorischen) Sinn; entscheidend ist danach ausschließlich, ob die handelnde Behörde den Polizeibehörden zuzuordnen ist. Der dritte Polizeibegriff, der sog. formelle Polizeibegriff, bezeichnet schließlich all jene Tätigkeiten, die von der Polizei im institutionellen (organisatorischen) Sinn wahrgenommen werden, unabhängig davon, wie dieses Handeln materiell zu qualifizieren ist.
Teil I Einführung in das Polizei- und Ordnungsrecht› § 1 Die einzelnen Polizeibegriffe› II. Der Begriff der Polizei im materiellen Sinn
II. Der Begriff der Polizei im materiellen Sinn
1. Die geschichtliche Entwicklung des materiellen Polizeibegriffs
2
Der Begriff der Polizei im materiellen Sinn umfasst nach heute hM jene Tätigkeit, die inhaltlich dadurch gekennzeichnet ist, dass sie der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung dient. Dieser materielle Polizeibegriffist das Ergebnis eines langen historischen Entwicklungsprozesses[1]. Der Begriff der Polizei umschrieb in seiner ursprünglichen Bedeutung einen Zustand guter Ordnung des Gemeinwesens. Von diesem Begriff gingen die Reichspolizeiordnungen von 1530, 1548 und 1577 sowie die Landespolizeiordnungen aus, die zur Verwirklichung und Erhaltung eines Zustandes „guter Polizey“ für nahezu alle Lebensbereiche der Untertanen umfassende Reglementierungen vorsahen (zB Vorschriften über Handel und Gewerbe, Erb-, Vertrags- und Liegenschaftsrecht, über die Religionsausübung, die allgemeine Sittlichkeit, Kleiderordnungen usw). Hierauf basierend wurde in den absolutistischen deutschen Territorialstaaten die Polizeigewalt zum Inbegriff der dem Fürsten zustehenden absoluten Staatsgewalt, des ius politiae. Davon wurden allerdings im Laufe der Zeit einzelne Bereiche abgesondert, nämlich die auswärtigen Angelegenheiten, das Heer- und Finanzwesen sowie die Justiz. Diese Polizeigewalt des Monarchen, die sich in Akten der Gesetzgebung wie der vollziehenden Gewalt artikulierte, unterlag keinen rechtlichen Beschränkungen, sondern gab dem Herrscher die Möglichkeit, in alle Lebensbereiche der Untertanen zur „Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt“ reglementierend einzugreifen. Man bezeichnete die absolutistischen Staaten des 18. Jahrhunderts deshalb auch als Polizeistaaten und die Tätigkeit, welche durch die Polizeigewalt ausgeübt wurde, als Polizei. Sie umfasste sowohl die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit als auch die Förderung der umfassend verstandenen, durch den Monarchen zu definierenden allgemeinen Wohlfahrt.
3
Gegen diesen weiten materiellen Polizeibegriff und die ihm korrespondierende umfassende Polizeigewalt des Monarchen wandte sich die liberal und individualistisch gesonnene Aufklärungsphilosophie. Bereits 1770 forderte der Göttinger Staatsrechtslehrer Johann Stephan Pütterin seinem Werk „Institutiones Iuris Publici Germanici“: „Politiae est cura avertendi mala futura; promovendae salutis cura non est proprie politiae“ (Aufgabe der Polizei ist die Sorge für die Abwendung bevorstehender Gefahren; die Wohlfahrt zu fördern ist nicht eigentlich Aufgabe der Polizei). Von dieser Einschränkung des Polizeibegriffs ging auch das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten vom 1.6.1794 (ALR) aus, das in § 10 Teil II Titel 17 (§ 10 II 17) bestimmte: „Die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung, und zur Abwendung der dem Publiko, oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorstehenden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizey“. Mit dieser Regelung war bezweckt sicherzustellen, dass staatliche Zwangsbefugnisse zur Förderung der Wohlfahrtspflege nicht mehr ohne eine besondere gesetzliche Grundlage ausgeübt werden konnten.
Читать дальше