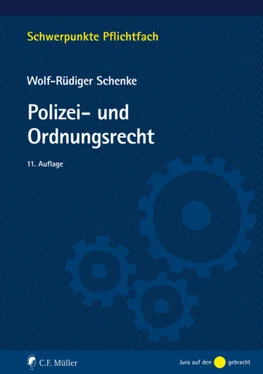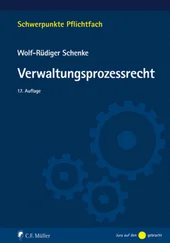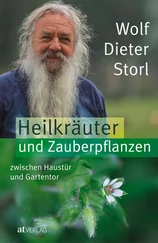Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur
I. Allgemeine Literatur, Bundespolizeirecht und Gesamtdarstellungen zum Polizeirecht
II.Literatur zum Landesrecht
1. Baden- Württemberg (BW)
2. Bayern (Bay)
3. Berlin (Berl)
4. Brandenburg (Brand)
5. Bremen (Brem)
6. Hamburg (Hamb)
7. Hessen (Hess)
8. Mecklenburg-Vorpommern (MV)
9. Niedersachsen (Nds)
10. Nordrhein-Westfalen (NW)
11. Rheinland-Pfalz (RhPf)
12. Saarland (Saar)
13. Sachsen (Sachs)
14. Sachsen-Anhalt (SachsAnh)
15. Schleswig-Holstein (SchlH)
16. Thüringen (Thür)
III. Sonstiges
Teil I Einführung in das Polizei- und Ordnungsrecht
§ 1 Die einzelnen Polizeibegriffe
I. Die verschiedenen Ansätze zur Bestimmung des Polizeibegriffs
II.Der Begriff der Polizei im materiellen Sinn
1. Die geschichtliche Entwicklung des materiellen Polizeibegriffs
2.Polizei im materiellen Sinn als die der Gefahrenabwehr dienende staatliche Tätigkeit
a) Die Gefahrenabwehr
b) Die Gefahrenvorsorge
c) Keine Einbeziehung der Strafverfolgungsvorsorge
III. Der Begriff der Polizei im institutionellen (organisatorischen) Sinn
IV. Der Begriff der Polizei im formellen Sinn
§ 2 Das Polizei- und Ordnungsrecht
I. Der Begriff des Polizei- und Ordnungsrechts
II. Die Gliederung des Polizei- und Ordnungsrechts
1. Die Gesetzgebungskompetenz der Länder zur Regelung des Polizei- und Ordnungsrechts
2. Die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes für Teilbereiche des Polizei- und Ordnungsrechts
3. Die Gesetzgebungskompetenz für die Strafverfolgung und die Strafverfolgungsvorsorge
Teil II Materielles Polizei- und Ordnungsrecht (Rechtsgrundlagen und Rechtsgrundsätze des polizeilichen Handelns)
§ 3 Die Polizeibefugnisse im Rahmen der Gefahrenabwehr
I.Das Erfordernis einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage für belastende Eingriffe
1. Zuweisung einer Aufgabe rechtfertigt grundsätzlich keine Eingriffsbefugnisse
2. Generalermächtigungen und Spezialermächtigungen
3. Keine Rechtsgrundlage durch allgemeine Rechtfertigungsgründe
4. Ermächtigungsgrundlage für grundrechtsrelevante Informationen der Bundes- bzw Landesregierung
5. Keine Ermächtigung durch grundrechtliche Schutzpflichten
6. Keine Ermächtigung durch staatliche Notrechte
II. Die polizei- und ordnungsbehördlichen Generalklauseln
1. Keine grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Bedenken gegen Generalklausel
2. Ausnahmsweise Erfordernis spezialgesetzlicher Ermächtigungen
3. Rechtsgrundlage für belastende Verwaltungsakte und Realakte
4. Uneingeschränkte Justitiabliltät der in der Generalklausel verwandten unbestimmten Rechtsbegriffe
5. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit
6. Der Begriff der öffentlichen Ordnung
7.Der Begriff der Gefahr
a) Gefahr als hinreichende Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts
b) Anscheinsgefahr
c) Scheingefahr
d) Gefahrenverdacht
e) Gefahrerforschungseingriff
f) Drohende Gefahr
8. Der Begriff der Störung
9. Das Ermessen der Polizei
a) Das Entschließungsermessen
b) Das Auswahlermessen
c) Der Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung
III. Traditionelle polizeiliche Verfügungen (Einzelmaßnahmen) in allgemeinen Polizei- und Ordnungsgesetzen (Standardmaßnahmen)
1. Die Identitätsfeststellung und die Prüfung von Berechtigungsscheinen
2. Erkennungsdienstliche Maßnahmen
3. Vorladung
4. Platzverweisung, Aufenthaltsverbot, Wohnungsverweisung, Kontaktverbot und elektronische Aufenthaltsüberwachung
5. Ingewahrsamnahme von Personen
6. Durchsuchung und Untersuchung von Personen
7. Durchsuchung von Sachen
8. Betreten und Durchsuchung von Wohnungen
9. Sicherstellung und Beschlagnahme
10. Verwertung, Einziehung, Vernichtung
IV. Datenerhebung und Datenverarbeitung
1. Allgemeines
2. Die Datenerhebung
a) Allgemeine Grundsätze
b) Die allgemeine Ermächtigung zur Datenerhebung
c) Die Befragung
d) Offene Bild- und Tonaufzeichnungen (Videoüberwachung)
e) Die offene Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnung mittels körpernah getragener Aufnahmegeräte Body-Cams)
f) Die polizeiliche Ausschreibung zur Beobachtung
g) Die Fahndung
3. Verdeckte Mittel der Datenerhebung
a) Allgemeines
b) Der Einsatz von technischen Mitteln zur Überwachung von Wohnungen (sog. „Großer Lauschangriff“)
c) Die Telekommunikationsüberwachung
d) Die sog. „Online-Durchsuchung“
e) Der Einsatz Verdeckter Ermittler
f) Der Einsatz von V-Leuten
g) Die längerfristige Observation
4. Die Datenverarbeitung
a) Allgemeines zur Speicherung, Veränderung und Nutzung von Daten
b) Die Zwecke der Datenverarbeitung
c) Speicherung
d) Der Datenabgleich
e) Die Datenübermittlung
f) Die Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Daten
g) Löschung, Berichtigung und Sperrung von Daten sowie Auskunftsansprüche
h) Weitere Folgen rechtswidriger Datenverarbeitungen
§ 4 Die polizeirechtlich Verantwortlichen (Störer)
I. Die Bedeutung des Störerbegriffs und die Arten der Störer
II. Potentiell polizeipflichtige Personen
III.Der Verhaltensstörer
1. Das Verhalten
2.Der polizeirechtliche Verursacherbegriff
a) Die polizeirechtliche Verursachung
b) Der Zweckveranlasser
c) Der „latente Störer“
d) Scheinstörer, „Anscheinsstörer“ und „Verdachtsstörer“
3. Haftung für das Verhalten anderer Personen (Zusatzverantwortlichkeit)
IV.Der Zustandsstörer
1. Allgemeines
2. Einschränkungen der Zustandsverantwortlichkeit unter dem Aspekt des Übermaßverbots
3. Die Beendigung der Zustandsverantwortlichkeit, insbesondere bei Dereliktion
4. Zustandsverantwortlichkeit und zivilrechtliche Verfügungsbefugnis
V. Verjährung und Verwirkung der polizeirechtlichen Verantwortlichkeit
VI.Die Auswahl zwischen mehreren Störern
1. Keine nur anteilige Verantwortlichkeit der Störer
2.Gleichzeitige Verantwortlichkeit mehrerer Störer für eine Gefahr
a) Ermessensleitende Gesichtspunkte bei der Auswahl
b) Gesamtschuldnerische Haftung und Rückgriffsmöglichkeiten der in Anspruch genommenen Person
VII. Rechtsnachfolge in polizeiliche Pflichten
§ 5 Der polizeiliche Notstand
I. Die Tatbestandsvoraussetzungen des polizeilichen Notstands
II. Der Umfang der Inanspruchnahme
§ 6 Verfassungsrechtliche Begrenzungen der Polizeibefugnisse
I. Rechtliche Bindungen durch das Übermaßverbot
1. Der Grundsatz der Geeignetheit des Mittels
2. Der Grundsatz des geringsten Eingriffs
3. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn
II. Sonstige Begrenzungen durch die Grundrechte
1. Begrenzungen durch Freiheitsgrundrechte mit Gesetzesvorbehalt
2. Begrenzungen durch nicht ausdrücklich einschränkbare Freiheitsgrundrechte
3. Begrenzungen durch sonstige Grundrechte
§ 7 Spezialgesetzliche Befugnisse der Polizei- und Ordnungsbehörden zur Gefahrenabwehr außerhalb der allgemeinen Polizei- und Ordnungsgesetze
I. Spezielle Gefahrenabwehrregelungen
II. Das Versammlungsrecht
1. Öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen
2.Öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel
a) Anmeldung einer Versammlung
b) Versammlungsverbot und Auflagen
c) Auflösung einer Versammlung
d) Maßnahmen unterhalb der Schwelle eines Verbots oder einer Auflösung
3. Verhältnis des VersG zum allgemeinen Polizeirecht und anderen polizeirechtlichen Vorschriften
Читать дальше