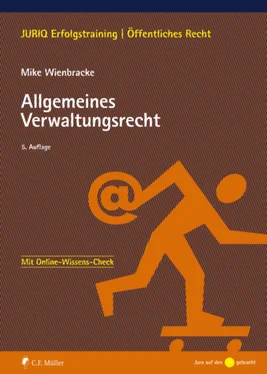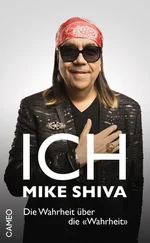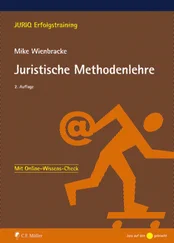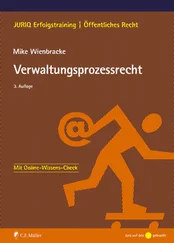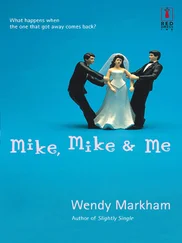Beispiel[94]
E ist Eigentümer von mit Mietwohngebäuden bebauten Grundstücken in der Gemeinde G. Mit den gegenüber seinen Mietern geltend gemachten Mieterhöhungsverlangen unterlag E in der Vergangenheit mehrfach vor den Zivilgerichten. Als Grund für diese Niederlagen hat E den Mietspiegel von G identifiziert, der seiner Ansicht nach die ortsübliche Vergleichsmiete zu niedrig angebe. Daher beabsichtigt E nunmehr Anfechtungsklage gegen den von G aufgestellten und veröffentlichten Mietspiegel zu erheben. Wäre diese Klageart statthaft?
Nein. Gem. § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO kann mittels der Anfechtungsklage nur die Aufhebung eines Verwaltungsakts begehrt werden. Die in § 35 VwVfG genannten Merkmale sind in Bezug auf die Aufstellung und Veröffentlichung des örtlichen Mietspiegels durch die Gemeinde jedoch gerade nicht erfüllt. Zwar handelt es sich hierbei um eine der öffentlichen Verwaltung zugewiesene Aufgabe. Ihre Wahrnehmung erfolgt jedoch lediglich in Form einer schlicht-verwaltenden Tätigkeit ohne bindende Außenwirkung. Die positiven oder negativen Einflüsse eines kommunalen Mietspiegels auf die Durchsetzbarkeit privater Mieterhöhungsansprüche verleihen ihm selbst noch keinen regelnden Charakter. Von Rechts wegen stellt er vielmehr nur ein formelles Begründungsmittel für Mieterhöhungsverlangen der Vermieter dar. Dies ist seine einzige ihm vom Gesetz beigelegte Funktion. Derartige behördliche Äußerungen ohne Bindungswirkung – namentlich Gutachten, antizipierte Gutachten oder schlichte Auskünfte – treffen gerade keine Regelung i.S.v. 35 S. 1 VwVfG. Die große praktische Bedeutung eines kommunalen Mietspiegels und sein ihm von den Zivilgerichten beigemessener hoher Beweiswert ändern daran nichts.
Da es sich beim Verwaltungsakt allerdings um eine Willenserklärung handelt und diese nicht nur in ausdrücklicher Form, sondern auch durch schlüssiges Verhalten (konkludent) erfolgen kann ( Rn. 43), kann eine rein tatsächliche Verwaltungshandlung mitunter allerdings zugleich auch eine schlüssige Anordnung, d.h. eine Regelung, beinhalten und somit bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 35 S. 1 VwVfG als Verwaltungsakt einzustufen sein. Diskutiert wird dies v.a. im Bereich des Polizeirechts. So ist bzgl. einiger der in den Polizeigesetzen der Länder vorgesehenen Standardmaßnahmenumstritten[95], ob diese die Polizei nicht nur zum Erlass eines Verwaltungsakts (z.B. Platzverweis, § 34 Abs. 1 PolG NRW; Rn. 336) bzw. nicht nur zur Vornahme eines Realakts (z.B. Festhalten, § 12 Abs. 2 S. 3 PolG NRW) ermächtigen, sondern ob in dem unzweifelhaft vorliegenden Realakt (z.B. Durchsuchung von Personen oder Sachen, § 39 bzw. § 40 PolG NRW) zugleich auch ein Verwaltungsakt enthalten ist, der den Betroffenen zur Duldung ihrer Vornahme verpflichtet ( konkludenter Duldungs-Verwaltungsakt; Klassiker: Realakt „Hieb mit Schlagstock durch Polizisten“ zugleich als konkludente Regelung „Dulde den Hieb!“). Soweit Letzteres v.a. in der Rechtsprechung[96] bejaht wird, hat diese lebensfremd anmutende Konstruktion vornehmlich historische Gründe. Vor dem Inkrafttreten der VwGO im Jahr 1960 wurde Verwaltungsrechtsschutz nämlich ausschließlich bei Vorliegen eines Verwaltungsakts gewährt. Seitdem ist die Qualifizierung einer Maßnahme als Verwaltungsakt jedoch nur noch für das „Wie“ (statthafte Klageart), nicht mehr aber für das „Ob“ der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs maßgeblich, siehe § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO. Folglich besteht unter der Geltung der VwGO keine Notwendigkeit, zwecks Gewährung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG) einen Regelungscharakter in Realakte „hineinzuinterpretieren“.[97] Entsprechendes gilt richtigerweise schließlich auch für die Fälle des sofortigen Vollzugs( Rn. 343 ff.), in denen die Verwaltung eine Maßnahme in Abwesenheit oder in Unkenntnis der betroffenen Person vornimmt. Der von der Gegenansicht insoweit bemühten und vor dem Hintergrund der Bekanntgabevorschriften der §§ 41 Abs. 1, 43 Abs. 1 VwVfG höchst problematischen Figur des adressatenlosen Verwaltungsakts (Rn. 345) bedarf es daher von vornherein nicht.
60
Ebenfalls mangels Regelungscharakter nicht um einen Verwaltungsakt handelt es sich bei behördlichen Wissenserklärungenwie Auskünften (vgl. § 25 VwVfG; Rn. 180 f.), Belehrungen, Warnungen, Empfehlungen, Hinweisen etc. (z.B. Gefahrzeichen i.S.v. § 40 StVO). Entsprechendes gilt – vorbehaltlich einer Entscheidung durch einen formellen Verwaltungsakt ( Rn. 42) – hinsichtlich der Ablehnung einer Auskunftetc., teilt die Ablehnung einer Amtshandlung als Kehrseite (actus contrarius) ihrer Vornahme doch deren Rechtsnatur. Abweichendes folgt richtigerweise auch nicht aus dem Umstand, dass der (Nicht-)Erteilung einer Auskunft – wie übrigens jeder anderen Verwaltungsmaßnahme auch – eine Entscheidung der Behörde vorausgeht, ob sie die Auskunft erteilt oder nicht. Außerhalb gesetzlich geregelter Fälle (vgl. z.B. §§ 5 Abs. 1 S. 4, 6 Abs. 2 UIG[98]) ist im Einzelnen streitig, ob die der (Nicht-)Vornahme einer Wissenserklärung vorgelagerte Behördenentscheidung eine Regelung enthält oder nicht. Während teilweise[99] danach differenziert wird, ob der Schwerpunkt der (Nicht-)Erteilung einer Auskunft in – dem Realakt – ihrer tatsächlichen (Nicht-)Erteilung oder in der verbindlichen Regelung über das Auskunftsverlangen (Indizien u.a.: Ermessen) liegt (dann: Verwaltungsakt), wird von anderen Stimmen[100] eine Parallele zum Konstrukt des konkludenten Duldungs-Verwaltungsakts ( Rn. 59) gezogen und ebenso wie dort auch im vorliegenden Zusammenhang das Vorhandensein eines Verwaltungsakts verneint.
Beispiel[101]
Nachdem in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist, dass ein Journalist Informationen über den Schriftsteller S an den BND weitergegeben hat, beantragt dieser dort die Erteilung von Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Mit der Begründung, dass die Auskunftserteilung die öffentliche Sicherheit gefährde, wurde der Antrag abgelehnt. Wäre eine von S bei dem gem. § 50 Abs. 1 Nr. 4 VwGO im ersten und letzten Rechtszug zuständigen BVerwG erhobene Klage zulässig?
Nein. Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen (Verpflichtungs-)Klage muss hier zunächst das behördliche Vorverfahren nach § 68 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 S. 1 VwGO stattfinden. Anspruchsgrundlage für das Begehren des S ist § 22 S. 1 BNDG i.V.m. § 15 BVerfSchG. Danach geht der Erteilung der Auskunft durch den BND eine „Entscheidung“ voraus, die vom Behördenleiter oder einem von ihm besonders beauftragten Mitarbeiter (§ 15 Abs. 2 S. 2 BVerfSchG) auf der Grundlage eines detaillierten gesetzlichen Prüfprogramms zu treffen ist (§ 15 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 BVerfSchG). Zudem enthält das Gesetz für den Fall der Ablehnung der Auskunftserteilung spezielle Vorschriften über die Begründung der Entscheidung (§ 15 Abs. 4 S. 1 und 3 BVerfSchG). Die ausdrückliche Erwähnung der Behördenentscheidung im Gesetz sowie die an sie gestellten verfahrens- und materiell-rechtlichen Anforderungen lassen erkennen, dass der rechtliche Schwerpunkt der behördlichen Tätigkeit nicht in der Erteilung oder Versagung der Auskunft als solcher, sondern in der zu Grunde liegenden Entscheidung zu sehen ist, die in der Form eines Verwaltungsakts (§ 35 S. 1 VwVfG) ergeht. Das Begehren des S ist mithin i.S.v. § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO auf den Erlass eines begünstigenden Verwaltungsakts gerichtet.
61
Neben den vorgenannten Realakten und behördlichen Wissenserklärungen fehlt es ferner auch bestimmten Willenserklärungender Verwaltung an dem für einen Verwaltungsakt erforderlichen Regelungscharakter. Insofern zu nennen sind zum einen solche behördlichen Willenserklärungen (genauer: rechtsgeschäftsähnliche Handlungen), die unmittelbar überhaupt keine Anordnung beinhalten, sondern an deren Vorhandensein das Gesetz vielmehr unabhängig vom Willen der erklärenden Behörde Rechtsfolgen knüpft (z.B. Aufrechnung gem. §§ 387 ff. BGB analog [ Rn. 46], Fristsetzung, Stundung, Mahnung, Kündigung, Ausübung des Zurückbehaltungsrechts).
Читать дальше