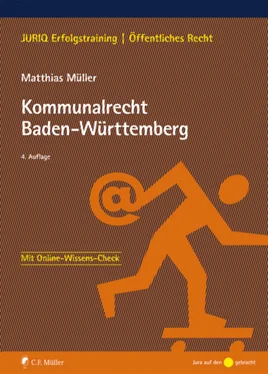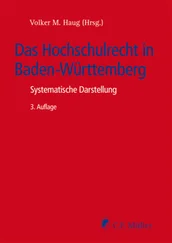| • |
Die Abspeicherpause (Augen zu) von 10 bis 20 Sekunden nach Definitionen, Begriffen und komplexen Lerninhalten zum sicheren Abspeichern und zur Konzentration. |
| • |
Die Umschaltpause von 3 bis 5 Minuten nach ca. 20 bis 40 Minuten Arbeit, um Abstand zum vorher Gelernten zu bekommen und dadurch Neues besser aufzunehmen. |
| • |
Die Zwischenpause von 15 bis 20 Minuten nach 90 Minuten intensiver Arbeit, also nach zwei Arbeitsphasen dient dem Erholen und Abschalten. |
| • |
Die lange Erholungspause von 1 bis 3 Stunden, z.B. mittags oder zum Feierabend nach 3 Stunden Arbeit ebenfalls zum richtigen Abschalten, Regenerieren, Sich-Belohnen etc. |
Ihre Mittagspause hat für Ihren Tagesrhythmus eine besondere Bedeutung!
Vor und nach dem Mittagessen sollte eine längere Erholungspause von mindestens 30 Minuten eingeplant werden, d.h. insgesamt mindestens 60 Minuten lernfreie Zeit. Ein Power Napping von ca. 20 Minuten nach dem Mittagsessen reicht oft aus. Dann ist man besonders fit. Von Arbeitsphysiologen wird der kurze und tiefe Mittagsschlaf empfohlen, womit dem Leistungstief von 13 bis 14 Uhr entgegengewirkt werden kann. Der Magen wird nach dem Mittagessen mit viel sauerstoffreichem Blut versorgt. Das fehlt ihrem Gehirn in dieser Phase also so oder so. Und durch das Nickerchen werden Aufmerksamkeit und Konzentration wieder gesteigert. Aber es sind alle Tätigkeiten erlaubt, die entspannen, schön sind, das Gehirn nicht belasten und fristgerecht beendet werden können.
Lernen am Abend ist weniger effektiv!
Das Lernen am späten Abend – also nach 22 Uhr ist wenig effektiv, da gemessen am Arbeitsaufwand weniger behalten wird. Vermeiden Sie also die Nachmittage mit Fernsehen, Verabredungen, Freizeit zu verbringen und hier viel Freizeitenergie zu investieren. Danach geistige Energie für Lernleistungen aufzubringen, fällt umso schwerer. Bei spätem Lernen schläft man erfahrungsgemäß auch schlechter und das, obwohl der nächste Tag wiederum Ihren vollen Einsatz erfordert. Seien Sie ehrlich zu sich und schauen Sie einmal, von welcher abendlichen Uhrzeit an die Lerneffektivität nachlässt.
Planen Sie mindestens 60 Minuten vor dem Schlafengehen vollkommen zum Entspannen ein. Sie können so mehr Abstand zum Lernen gewinnen und der Schlaf wird umso erholsamer sein. Andernfalls grübeln Sie weiter über Ihren Lernstoff, und Sie stehen am nächsten Morgen mit einem „Lernkater“ auf. Alkohol oder Schlafmittel beeinträchtigen die Lernarbeit im Schlaf erheblich. Nur im erholsamen Schlaf arbeitet das Gehirn gerne für Sie eigenverantwortlich weiter.
Den Schlaf als Lernorganisator nutzen!
Es ist nachgewiesen, dass sich unser Gehirn während des Schlafens nicht ausruht, der Arbeitsmodus schaltet um und das Gehirn wird zum Verwalter und Organisator des Gelernten. Das Gehirn bzw. die neuronale Aktivität sichtet, sortiert und ordnet zu, schafft Verbindungen (Synapsen) zu bereits bestehenden Wissensinhalten und verankert Gelerntes – ohne dass wir bewusst und aktiv etwas tun müssen. Diese Erkenntnisse erklären wahrscheinlich auch die lernförderlichen Wirkungen des Kurzschlafes (Power Napping) und der kurzen und tiefen Entspannung mit Hypnose.
1. Teil Rechtliche Grundlagen des Kommunalrechts
1
Lesen Sie die Inhaltsverzeichnisse von GemO und LKrO und vergegenwärtigen Sie sich, wie diese strukturiert sind
Das Kommunalrecht regelt im Schwerpunkt die Rechtsstellung und Organisation der kommunalen Körperschaften, also der Gemeinden, der Gemeindeverbände, der Landkreise und der weiteren Verbände (z.B. Nachbarschafts- oder Regionalverbände). Die Gesetzeskompetenz für diese Rechtsmaterie liegt grundsätzlich bei den Ländern (vgl. Art. 70 GG).
2
Die für das Studium wichtigsten kommunalrechtlichen Gesetze sind die
| • |
Gemeindeordnungfür Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.7.2000 (GemO), betreffend die Gemeinden und die |
| • |
Landkreisordnungfür Baden-Württemberg i.d.F. vom 19.6.1987 (LKrO) betreffend die Landkreise. |
3
Sowohl die GemO als auch die LKrO sind Gesetze im formellen Sinn, wenngleich die Bezeichnung als „Ordnung“ nicht ohne weiteres darauf schließen lässt.
4
Verschaffen Sie sich auch einen groben Überblick über diese Gesetze, indem Sie wenigstens die Überschriften der Paragraphen lesen!
Daneben existieren weitere Vorschriften, die spezielle Teilbereiche des Kommunalrechts (teils in Ergänzung der Vorschriften von GemO und LKrO) gesondert regeln, wie etwa
| • |
das Kommunalabgabenrecht(geregelt im Kommunalabgabengesetz, KAG), |
| • |
das Recht der kommunalen Zusammenarbeit(Schwerpunkt der gesetzlichen Grundlage hierfür ist das Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit, GKZ), |
| • |
das Kommunalwahlrecht(normiert im Kommunalwahlgesetz, KomWG, und in der Kommunalwahlordnung, KomWO), |
| • |
die Vorschriften zum Haushalts- und Kassenrecht(in der Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) und |
| • |
die Regelungen zum Eigenbetriebsrecht(geregelt im Eigenbetriebsgesetz, EigBG, und der Eigenbetriebsverordnung, EigBVO). |
2. Teil Die Gemeinden im Staatsaufbau
Inhaltsverzeichnis
A. Gliederung des Bundes und der Länder
B. Unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung
C. Gemeinden und Landkreise als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung
D. Arten von Gemeinden
2. Teil Die Gemeinden im Staatsaufbau› A. Gliederung des Bundes und der Länder
A. Gliederung des Bundes und der Länder
5
Bevor das Kommunalrecht i.e.S. dargestellt wird, folgen zunächst Ausführungen dazu, welche Stellung die Gemeinden im Staatsaufbau einnehmen.
6
Die Bundesrepublik ist aufgrund der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes ein Bundesstaat (Art. 20 Abs. 1 GG). Das Grundgesetz geht von einem zweigliedrigen Staatsaufbauaus, innerhalb dessen nur Bund und Länder Staatsqualität genießen,[1] d.h. nur der Bund und die Länder haben eine Verfassung, eine originäre Rechtssetzungskompetenz u.s.f.
Die Gemeinden hingegen sind, wenngleich rechtlich selbstständig, im Staatsaufbau ausschließlich dem Verfassungsbereich der Länder zugeordnet und damit Untergliederungen der Länder. Sie sind in den Verwaltungsaufbau der Länder integriert. Dementsprechend haben sie keine originäre Gesetzgebungskompetenz; ihnen kommt lediglich ein vom Staat verliehenes Satzungsrecht zu. Auch findet sich innerhalb der Gemeinde keine Gewaltenteilung i.e.S. Wenngleich der Gemeinderat teils normsetzend tätig wird (etwa bei Erlass von Satzungen), ist er doch Verwaltungsorgan.
[1]
StGH BW Urteil vom 10.5.1999 – 2/97, VBlBW 1999, 294-304.
2. Teil Die Gemeinden im Staatsaufbau› B. Unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung
B. Unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung
2. Teil Die Gemeinden im Staatsaufbau› B. Unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung› I. Unmittelbare Staatsverwaltung
I. Unmittelbare Staatsverwaltung
7
Die Verwaltung innerhalb der Länder wird in unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung unterteilt. Die unmittelbare Staatsverwaltungwird vom Land selbst in seiner Funktion als Hoheitsträger mit eigener Rechtspersönlichkeit als Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgeübt. Es bedient sich hierbei der rechtlich unselbstständigen Landesbehörden. (Verwaltungs-)Träger der unmittelbaren Staatsverwaltung ist das Land.
Читать дальше