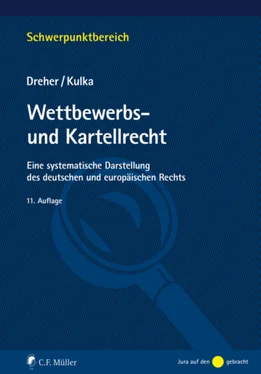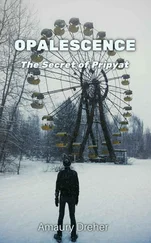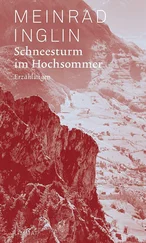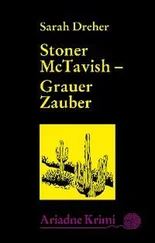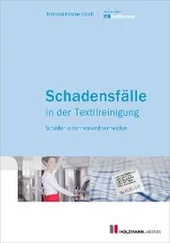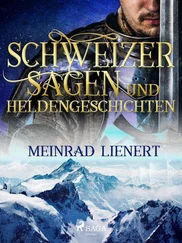224
Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass, den unbestimmten Rechtsbegriff „unternehmerische Sorgfalt“ grundsätzlich anders zu behandeln als den Unrechtstatbestand in § 3 Abs. 1 UWG. Daher kann an dieser Stelle auf die vorstehenden Ausführungen zu § 3 Abs. 1 UWG (vgl. Rdnr. 198 ff) verwiesen werden. Das gilt auch für den Stellenwert der in § 3 Abs. 2 UWG ausdrücklich genannten Marktgepflogenheiten; denn diese binden den Rechtsanwender auch bei Handlungen gegenüber Verbrauchern nicht, sondern sind von ihm nur zu „berücksichtigen“ und stehen dabei unter dem Vorbehalt einer normativ zu bestimmenden „Anständigkeit“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UWG (Nr. 9 RegE) ). Soweit die Rechtsprechung im Fall von § 3 Abs. 1 UWG für die nicht speziell geregelten Fälle eine Prüfung verlangt, ob die betroffenen Verhaltensweisen von ihrem Unlauterkeitsgehalt her den in den §§ 3a ff UWG angeführten Beispielsfällen entsprechen,[144] ist dies im Fall der „unternehmerischen Sorgfalt“ auf den Unrechtsgehalt der Art. 6 ff UGP-RL in der Interpretation durch den EuGH und der Umsetzung im UWG zu beziehen. Darüber hinaus orientiert sich der BGH an der Zielsetzung der UGP-RL, „dem Verbraucher eine informationsgeleitete und freie, mithin rationale Entscheidung zu ermöglichen“ (vgl. Art. 2 lit. e UGP-RL),[145] der EuGH an den „berechtigten Erwartungen eines Durchschnittsverbrauchers“.[146] Dieser darf insbesondere nicht dazu verleitet werden, seine Pflichten gegenüber Dritten zu verletzen.[147]
225
Auch § 3 Abs. 4 UWG, der Art. 5 Abs. 2 lit. b und Abs. 3 UGP-RL umsetzt, nennt den Durchschnittsverbraucher als Bezugspunkt für die Justierung des Maßstabs. Nach § 3 Abs. 4 S. 1 UWG ist bei der Beurteilung geschäftlicher Handlungen gegenüber Verbrauchern auf einen „durchschnittlichen Verbraucher oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mitglied dieser Gruppe abzustellen“. Damit übernimmt das Gesetz aus UGP-RL und Judikatur das Leitbild des informierten, verständigen und situationsadäquat aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers.[148] § 3 Abs. 4 S. 2 UWG engt den Kreis für besonders schutzbedürftige Verbraucherweiter ein, wenn für den Unternehmer vorhersehbar ist, dass seine geschäftlichen Handlungen das wirtschaftliche Verhalten „nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen“, und diese Verbraucher „auf Grund von geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese geschäftlichen Handlungen oder die diesen zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen besonders schutzbedürftig sind“. Damit wird die noch umständlicher formulierte Regelung in Art. 5 Abs. 3 S. 1 UGP-RL umgesetzt. Auf den Vorbehalt in Art. 5 Abs. 3 S. 2 UGP-RL (übertriebene oder nicht wörtlich zu nehmende Behauptungen) hat der deutsche Gesetzgeber stillschweigend verzichtet.
226
Die Eignungsklausel des § 3 Abs. 2 UWG setzt Art. 5 Abs. 2 lit. b(weiter Unlauterkeitsbegriff) um und wird ergänzt durch die Legaldefinitionen in § 2 Abs. 1 Nr. 8 und 9 UWG (Nr. 1 und 11 RegE) zur Umsetzung von Art. 2 lit e und k UGP-RL.[149] Sie enthält mehrere Elemente: zunächst die Eignung der Handlung zur Beeinträchtigung der „Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte Entscheidung zu treffen“; sodann die „Spürbarkeit“ dieser Beeinträchtigung; schließlich die wettbewerbliche Relevanz der Beeinträchtigung („zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte“).
227
Die Eignung der Handlung zur Beeinträchtigung des Verbrauchers bezieht sich ausschließlich auf seine Fähigkeit, eine informierte Entscheidung zu treffen. Das stellt einen großen Vorteil gegenüber Eignungsklauseln dar, die in unbestimmter Weise auf eine Beeinträchtigung der „Interessen“ der Marktteilnehmer abstellen. Die Bedeutung des Merkmals „informierte Entscheidung“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 UWG (Nr. 11 RegE) i. V. m. Art. 2 lit. e UGP-RL) ist allerdings nicht sehr klar. Es dürfte den Schutz von Verbrauchern bei un-„informierten“ Entscheidungen, z. B. bei spontanen Geschäften über Produkte von geringem Wert, nicht von vornherein ausschließen.
228
Das Kriterium der Spürbarkeitbezieht sich nur auf die Beeinträchtigung der vorgenannten Entscheidungsfähigkeit. Die amtlichen Begründungen der Gesetzentwürfe haben nicht erkennen lassen, wie diese Spürbarkeit festgestellt werden soll. Daher ist die Konkretisierung durch den EuGH abzuwarten. Bis dahin bieten die beim Spürbarkeitserfordernis in § 3 Abs. 1 UWG herangezogenen Kriterien, vor allem der Art und Schwere des Verstoßes, Anhaltspunkte (vgl. Rdnr. 214).[150]
229
Darüber hinaus muss die (Eignung zur) Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit wettbewerbliche Relevanzbesitzen („zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte“). Das unterstreicht auch EG 7 UGP-RL, der die Anwendung der Richtlinie ausdrücklich von einem „unmittelbaren Zusammenhang mit der Beeinflussung der geschäftlichen Entscheidung des Verbrauchers in Bezug auf Produkte“ abhängig macht. Andere Entscheidungen des Verbrauchers erfasst die Eignungsklausel nicht. Der Begriff der „geschäftlichen Entscheidung“, den die Bundesregierung zunächst für aus sich heraus verständlich und deshalb nicht umsetzungsbedürftig hielt,[151] ist heute in § 2 Abs. 1 Nr. 9 UWG (Nr. 1 RegE) legaldefiniert. Er darf nicht zu eng verstanden werden und bezieht sich nicht nur auf den eigentlichen Erwerbsvorgang, sondern auch auf damit zusammenhängende Entscheidungen wie etwa das Betreten eines Geschäfts oder das Aufsuchen einer Seite im Internet.[152]
E. § 3 Abs. 3 UWG und der Anhang
230
§ 3 Abs. 3 UWG setzt Art. 5 Abs. 5 UGP-RL um und bestimmt, dass die im Anhang des UWG aufgeführten geschäftlichen Handlungen „stets“ unzulässig sind. Das bedeutet, dass in diesen Fällen das Relevanz- und Spürbarkeitserfordernis entfällt, so dass man von Per-se-Verbotensprechen kann. Die Verbote gelten jedoch nur bei geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern. Der Anhang orientiert sich im Aufbau an Anhang I UGP-RL und führt zuerst die irreführenden Geschäftspraktiken auf (Nr. 1 bis 24 (Nr. 1 bis 23c RegE) ), danach die aggressiven Handlungen (Nr. 25 bis 30 (Nr. 24 bis 31 RegE) ). Diese Reihenfolge ist nicht mit der inneren Ordnung der §§ 3a ff UWG abgestimmt.
231
Außerdem führt das UWG bisher die in Nr. 31 Anh. I UGP-RL geregelte aggressive Geschäftspraktik (zu Recht) als irreführende Handlung in Nr. 17 Anh. UWG auf, was jedoch eine unschöne Verschiebung der Ordnungsziffern zur Folge hat (vgl. unten Rdnr. 233): Nr. 18 bis 26 Anh. UWG entsprechen Nr. 17 bis 25 Anh. I UGP-RL. Nr. 26 Anh. I UGP-RL wird bisher in § 7 UWG umgesetzt, so dass die Verschiebung der Ordnungsziffern an dieser Stelle endet. Der RegE GSVW schlägt deshalb vor, die Verschiebung der Ordnungsziffern zu beseitigen und im Sinn eines geringeren Übels den Anhang des UWG im Aufbau an den (wenig systematischen) Anhang der UGP-RL anzugleichen (vgl. Rdnr. 233).[153] Gleichzeitig soll die RL (EU) 2019/2161 umgesetzt werden, die vier neue Per-se-Verbote (Nr. 11a und Nrn. 23a bis 23c Anh. I UGP-RL) enthält.
232
§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 UWG, nicht mehr jedoch § 3 Abs. 2 UWG, enthalten jeweils ein Verbot („sind unzulässig“). Die Sanktionen bei einer Zuwiderhandlung ergeben sich dagegen aus dem mit „Rechtsfolgen“ überschriebenen Kapitel 2 des UWG (§§ 8 ff UWG). Es sind dies die Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung (§ 8 UWG), Schadensersatz (§ 9 UWG) und Gewinnabschöpfung (§ 10 UWG). Sie werden ergänzt durch Hilfsansprüche auf Auskunftserteilung und den Anspruch auf Ersatz der Abmahnkosten (§ 13 Abs. 3 UWG). Die Einzelheiten werden unten § 4 näher dargestellt.
Читать дальше