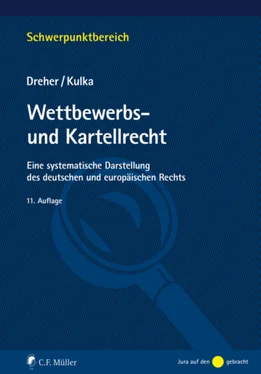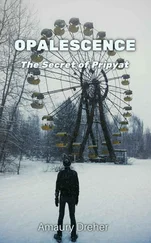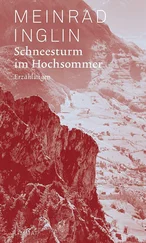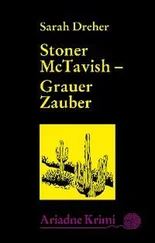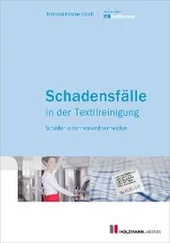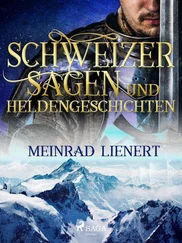197
In einem konkreten Fall geht die Prüfung der Unlauterkeitdaher von den besonderen Tatbeständen der §§ 3a ff UWG aus. Bereits hier kann sich die Aufgabe der Konkretisierung stellen, wenn ein Tatbestand weit gefasst ist (vgl. z. B § 4 Nr. 4 und § 4a Abs. 1 UWG). Wenn sich der Sachverhalt nicht unter einen der besonderen Tatbestände subsumieren lässt, muss die Unlauterkeit durch direkten Rückgriff auf § 3 Abs. 1 UWG konkretisiert werden. Erforderlich ist dann nach Ansicht des BGH die Prüfung, ob das betreffende Verhalten von seinem Unlauterkeitsgehalt her den in den Beispielsfällen der §§ 3a ff UWG geregelten Verhaltensweisen entspricht.[112]
2. Die Aufgabe der Konkretisierung
198
Der Maßstab der Unlauterkeit ist normativerArt. Er verweist nicht auf die in der Rechtswirklichkeit bestehenden Gebräuche, Gepflogenheiten oder „Standards“, die der Rechtsanwender nur empirisch zu ermitteln hätte. Die Anschauungen der beteiligten Verkehrskreise geben dem Rechtsanwender Hinweise und Anregungen, mehr nicht. Das gleiche gilt für die „Verhaltenskodices“ i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 5 UWG (Nr. 10 RegE) und Art. 2 lit. f, 10 UGP-RL. Sie stehen nicht über dem Recht und können dieses auch nicht ersetzen, sondern lediglich Aufschluss darüber geben, was in der Rechtswirklichkeit als zweckmäßig und gerecht angesehen wird.
199
Der Rechtsanwender hat daher selbst zu entscheiden, was in einem konkreten Fall der „Anstand“ gebietet, und ob die betroffene geschäftliche Handlung diesem Gebot entspricht.[113] Die Entscheidung erfolgt durch Bewertungder Tatsachen an Hand rechtlicher Maßstäbe, nicht – jedenfalls nicht ausschließlich und auch nicht überwiegend – durch Beweisaufnahme über die herrschende Verkehrsauffassung. Die Maßstäbehat der Rechtsanwender vor allem der Entstehungsgeschichte und dem Zweck der Generalklausel, ihrem systematischen Zusammenhang mit einschlägigen Vorschriften innerhalb und außerhalb des UWG sowie den Vorgaben des Verfassungsrechts zu entnehmen. Auch Präjudizien spielen im Wettbewerbsrecht eine erhebliche Rolle.
200
Demzufolge verlangt die Konkretisierung der „Unlauterkeit“ mehr – und anderes – als eine Abwägung der Interessender beteiligten Marktteilnehmer, auch wenn Rechtsprechung und Literatur immer wieder auf dieses Instrument zurückgreifen.[114] Soweit es um die individuellen Belange der Marktteilnehmer geht, schützt das UWG – als Sonderdeliktsrecht – ohnehin nicht abstrakte „Interessen“, sondern konkrete, wettbewerblich relevante Rechtsgüter (vgl. Rdnr. 89 ff). Das ebenfalls zu berücksichtigende kollektive „Interesse der Allgemeinheit“ an einem unverfälschten Wettbewerb (§ 1 S. 2 UWG (Abs. 1 S. 2 RegE) ) ist außerdem anderer Art als die Interessen der Marktteilnehmer, weil ihm ein greifbares Zuordnungssubjekt fehlt, und lässt sich schon deshalb nicht einfach „aufwiegen“. Vor allem wird der Vorgang einer „Abwägung“, bei dem sich die Waage einem einzelnen Interesse zuneigen müsste, der in § 1 UWG (Abs. 1 RegE) zum Ausdruck gebrachten Gleichberechtigung der Schutzzwecke (vgl. Rdnr. 102) nicht gerecht.
201
Der Vorgang der Konkretisierung des Merkmals der Unlauterkeit ist daher ein von rechtlichen Maßstäben geleiteter Prozess wechselseitiger Anpassung, in dem ggf. zwischen den verschiedenen betroffenen Schutzzwecken des UWG praktische Konkordanz hergestellt werden muss. In diesem Prozess hat die Konkretisierung immer von einem bestimmten Sachverhaltauszugehen. Erforderlich ist eine „ Gesamtwürdigungder Umstände des jeweiligen Einzelfalls“,[115] des „Gesamtcharakters“des betroffenen Verhaltens nach seinem konkreten Anlass, seinem Zweck, den eingesetzten Mitteln, seinen Begleitumständen.[116] Die für einen konkreten Fall entwickelten Grundsätze dürfen nur mit Vorsicht auf andere Fälle übertragen werden.
3. Die Maßstäbe der Konkretisierung
202
Die Maßstäbezur Konkretisierung der Unlauterkeit ergeben sich aus normativen Vorgaben innerhalb und außerhalb des UWG. UWG-immanent sind zunächst die Entstehungsgeschichteund der Zweckder Generalklausel.[117] Beide sind untrennbar verbunden mit der oben Rdnr. 51 ffdargestellten Entstehungsgeschichte des Gesetzes im Ganzen und seinem oben Rdnr. 85 ffdargestellten Zweck. Die Konkretisierung wird darüber hinaus geleitet von dem systematischen Zusammenhangder Generalklausel mit den Regelungen der Beispielstatbestände in §§ 3a ff UWG.[118] Heranzuziehen sind schließlich die Präjudizienaus der bisherigen Rechtsprechung, die auch ohne Bindungswirkung im strengen Sinn die Praxis des Wettbewerbsrechts bestimmen.
203
Die Konkretisierung der Generalklausel hat ferner „wettbewerbsbezogen“ zu erfolgen[119] und das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb (§ 1 S. 2 UWG (Abs. 1 S. 2 RegE) ) zu beachten. Das Postulat eines „Wettbewerbsbezugs“darf aber nicht mit dem Rückgriff auf das Konzept des Leistungswettbewerbs verwechselt werden, auch wenn letzteres in der Rechtsprechung immer wieder herangezogen wurde;[120] denn aus den oben Rdnr. 100genannten Gründen ist der sog. Leistungswettbewerb für die Konkretisierung der Generalklausel ungeeignet. Er hat denn auch in der Entstehungsgeschichte der Novellen seit 2004 keine nennenswerte Rolle mehr gespielt.
204
Maßstäbe für die Konkretisierung finden sich ferner außerhalb des UWG. Zwar kann es nicht auf das ankommen, was im Sinn der älteren Rechtsprechung von der Allgemeinheit – oder den beteiligten Verkehrskreisen – „missbilligt und für untragbar gehalten“ wird. Nicht konkret genug sind auch die Formeln vom ordre public oder von „Gesetz und Recht“.[121] Doch machen sie deutlich, dass die Konkretisierung den systematischen Zusammenhangdes UWG mit anderen einschlägigen Gesetzen und Vorschriften zu berücksichtigen hat. Angesichts der Einheit der Rechtsordnungdarf sich die Konkretisierung der Generalklausel deshalb nicht in Widerspruch zu den Grundwertungen dieser anderen Normen setzen. Das gilt vor allem für das Kartellrecht in GWB und AEUV.
205
Schließlich leiten die Vorgaben des Verfassungs- und EU-Rechts(vgl. Rdnr. 73 ff, 116) die Konkretisierung der Generalklausel. Einfaches Recht darf nicht Verfassungsrecht, deutsches Recht nicht EU-Recht verletzen.[122] Verfassungsrechtlich ist aber zu beachten, dass die Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte des Einzelnen gegen staatliches Handeln sind und deshalb aus ihnen nicht ohne Weiteres Ansprüche auf wettbewerbsrechtlichen Schutz hergeleitet werden können.
Beispiel: BGH vom 12.7.2007 – I ZR 18/04 – Jugendgefährdende Medien bei eBay = BGHZ 173, 188
Sachverhalt:Registrierte Verkäufer bieten über die Internetplattform eBay, die von E betrieben wird, Spiele und Tonträger mit rechtswidrigem Inhalt (Volksverhetzung, Gewaltverherrlichung, Jugendgefährdung) an. E entfernt nach entsprechenden Hinweisen jeweils unverzüglich die beanstandeten Angebote, lehnt es aber ab, vorbeugend tätig zu werden. I, ein Interessenverband des Videofachhandels (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG), hält das Verhalten von E für unlauter und verlangt, die Plattform von vornherein für rechtswidrige Angebote nicht zur Verfügung zu stellen. E entgegnet, sie selbst handle nicht rechtswidrig und sei weder willens noch in der Lage, rechtswidrige Angebote vorab zu identifizieren. Ist das Verhalten von E wettbewerbsrechtlich zu beanstanden?
Lösung:E hat nicht unlauter im Sinn eines Rechtsbruchs (§ 3 Abs. 1 i. V. m. § 3a UWG) gehandelt, weil die genannten Verbote nur für die Verkäufer gelten. Sie ist auch nicht Gehilfin eines Rechtsbruchs (§ 830 Abs. 2 BGB analog), weil sie beim Einstellen keinen Gehilfenvorsatz, der das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließt, hat. – E könnte aber in direkter Anwendung von § 3 Abs. 1 UWG unlauter gehandelt haben. Dann müsste sie den anständigen Gepflogenheiten in Handel, Gewerbe, Handwerk oder selbstständiger beruflicher Tätigkeit zuwidergehandelt haben. Das wäre auch dann der Fall, wenn sie es pflichtwidrig unterlassen hätte, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Die „geschäftliche Handlung“ i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) läge hier in einem Unterlassen, das von dem weiten Begriff „Verhalten“ erfasst wird. Unlauter wäre das Unterlassen dann, wenn E eine „wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht“ träfe. Diese entsteht, wenn der Unternehmer durch sein Handeln die ernsthafte Gefahr begründet, dass wettbewerbsrechtlich geschützte Interessen von Marktteilnehmern verletzt werden. Sie verpflichtet den Unternehmer, die Gefahr im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren zu begrenzen. Zwar begründet hier die Bereitstellung der Internetplattform als solche noch keine Gefahr für andere Marktteilnehmer. Da jedoch schon mehrfach rechtswidrige Angebote eingestellt wurden und E Kenntnis davon erlangt hat, muss sie Vorsorge dafür treffen, dass es möglichst nicht zu weiteren gleichartigen Rechtsverletzungen kommt. Allerdings sind rechtswidrige Angebote im Massengeschäft schwer zu erkennen. Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln (Filtersoftware, Altersverifikationssysteme etc.) ist aber nicht von vornherein unmöglich oder unzumutbar. E trifft daher die Pflicht, derartige Hilfsmittel zu prüfen und ggf. einzusetzen. Das Unterlassen jeglicher vorbeugender Maßnahmen ist folglich pflichtwidrig und unlauter.
Читать дальше