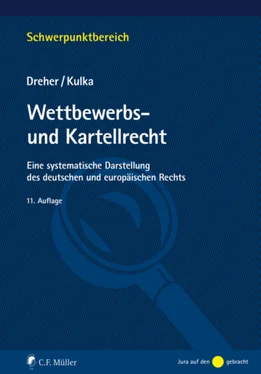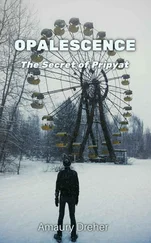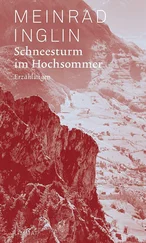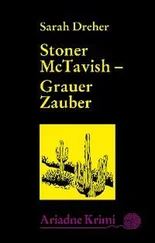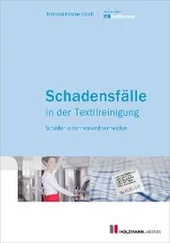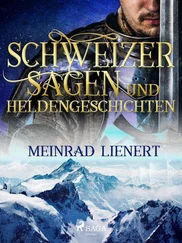Merke: Verhalten zugunsten eines „Unternehmens“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 (Nr. 2 RegE) UWG)
Der Begriff „Unternehmen“ ist (anders als der Begriff „Unternehmer“) im UWG nicht definiert. Sein Gebrauch ist nicht einheitlich. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 (Nr. 2 RegE) UWG wird ein funktionaler Unternehmens-Begriff verwendet, der nicht auf das handelnde Rechtssubjekt, sondern auf die Art seines Handelns abstellt. Mit Hilfe des Unternehmens-Begriffs werden Handlungen zu rein privaten Zwecken, arbeitsrechtlich geregelte Handlungen und bestimmte Handlungen der öffentlichen Hand vom UWG ausgenommen. Die öffentliche Hand handelt vor allem dann nicht als „Unternehmen“, wenn sie auf Grund konkreter gesetzlicher Ermächtigung – mit den Mitteln von Zwang und Anordnung oder auf andere Weise – hoheitlich tätig wird. Wird sie dagegen ohne konkrete gesetzliche Ermächtigung schlicht hoheitlich oder in den Formen des Privatrechts erwerbswirtschaftlich tätig, ist sie „Unternehmen“.
Beispiel: BGH vom 18.1.2012 – I ZR 170/10 – Betriebskrankenkasse = GRUR 2012, 288; EuGH vom 3.10.2013 – C-59/12 – BKK Mobil Oil = WRP 2013, 1454
Sachverhalt:Die Betriebskrankenkasse BKK, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, veröffentlicht im Internet einen Text, der die Versicherten davon abbringen soll, die Krankenversicherung zu wechseln. Dieser Text enthält irreführende Angaben (§ 3 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 1 UWG). Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG) verlangt von BKK Unterlassung gem. § 8 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 UWG. BKK vertritt die Ansicht, der Text im Internet sei keine geschäftliche Handlung, sie selbst kein Unternehmen i. S. v. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) . Ist das richtig?
Lösung:Voraussetzung für eine „geschäftliche Handlung“ ist nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) u. a. ein Verhalten zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens. Fraglich ist, ob BKK ein „Unternehmen“ im Sinn dieser Vorschrift ist. Anders als der Begriff „Unternehmer“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 6 UWG (Nr. 8 RegE) ) wird der Begriff „Unternehmen“ im UWG nicht definiert. Auch wenn das UWG als „Unternehmen“ oft das Vermögen des Unternehmers bezeichnet (vgl. § 4 Nr. 2, § 8 Abs. 2 UWG), wird ein institutionelles Verständnis dem Begriff im Kontext von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) nicht gerecht. Der Begriff ist daher wie im Kartellrecht funktional zu verstehen und auf die betroffene Tätigkeit zu beziehen. Dann geht es im vorliegenden Fall um eine wirtschaftliche Tätigkeit, nämlich den Absatz von Versicherungsdienstleistungen. Zudem muss sich die Auslegung an den Begriffen „Unternehmen“ und „Gewerbetreibender“ in Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 lit. b und d UGP-RL orientieren. Zwar hat es der EuGH im Kartellrecht abgelehnt, die Tätigkeit der gesetzlichen Krankenkassen als wirtschaftliche Tätigkeit einzustufen, und das damit begründet, dass sie einen „rein sozialen Zweck“ verfolgen (EuGH, Poucet und Pistre , Slg. 1993, I 637 Rn. 15, 18). Für die UGP-RL soll dies jedoch nicht ausschlaggebend sein. Hier hat der EuGH entschieden, dass die Kassen zur Erreichung eines hohen Verbraucherschutzniveaus „Gewerbetreibende“ und damit auch „Unternehmen“ i. S. d. UGP-RL sind. Der Text der BKK im Internet ist deshalb eine geschäftliche Handlung.
IV. Die betroffenen Produkte
180
Die geschäftliche Handlung bezieht sich nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 (Nr. 2 RegE) Halbs. 1 UWG auf bestimmte Produkte,[61] nämlich auf „Waren oder Dienstleistungen“, wobei Grundstücke als Waren gelten, Rechte und Verpflichtungen als Dienstleistungen (Halbs. 2).[62] Auf Grund von Art. 3 RL (EU) 2019/2161 schlägt der RegE GSVW die weitere Klarstellung vor, dass zu den „Waren“ auch „digitale Inhalte“ und zu den „Dienstleistungen“ auch „digitale Dienstleistungen“ gehören.[63] Der Wortlaut von § 2 Abs. 1 Nr. 1 (Nr. 2 RegE) UWG lehnt sich an Art. 2 lit. c UGP-RL an, vermeidet aber die Zusammenfassung von Waren und Dienstleistungen in einem Begriff („Produkt“) und weicht mit dem Ausdruck „Dienstleistungen“ von den „gewerblichen Leistungen“ des Kartellrechts ab (vgl. z. B. § 18 Abs. 1 GWB).[64] Geschäftliche Handlungen können sich daher grundsätzlich auch auf das Angebot von oder die Nachfrage nach Arbeitsleistungen beziehen.
181
Geschäftliche Handlung kann nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) „jedes Verhalten“ einer (natürlichen) Person sein. Der Gesetzgeber des UWG 2008 ist an dieser Stelle bewusst von der früheren Formulierung abgewichen, nach der eine „Handlung“ erforderlich war. Er wollte zum Ausdruck bringen, dass neben einem positiven Tun auch ein Unterlassenals Wettbewerbsverstoß in Betracht kommt.[65] Allerdings wurde ein pflichtwidriges Unterlassen schon zuvor als wettbewerbswidrig angesehen,[66] insbesondere bei Verletzung einer wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflicht.[67] Insofern bewirkte die neue Formulierung keine Änderung der Rechtslage. Sie ist jedoch eleganter als die umständliche Aufzählung in Art. 2 lit. d UGP-RL („jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung, kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung und Marketing“), der durch § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) umgesetzt wird. Der BGH verlangt für das pflichtwidrige Unterlassen eine Garantenstellunggegenüber dem Anspruchsberechtigten zur Abwendung des wettbewerbswidrigen Erfolges, die sich aus vorhergehendem gefährdendem Tun (Ingerenz), Gesetz, Vertrag oder der Inanspruchnahme von Vertrauen ergeben kann.[68]
Merke: Unterlassen als geschäftliche Handlung
Geschäftliche Handlung („jedes Verhalten“) kann auch ein Unterlassen sein. Unlauter ist das Unterlassen aber nur dann, wenn eine Pflicht zum Handeln besteht, die aus einer Garantenstellung gegenüber dem Anspruchsberechtigten folgt. Diese Pflicht kann sich ausdrücklich aus Gesetz oder Vertrag ergeben, muss in vielen Fällen jedoch besonders hergeleitet werden. Speziell aus einem vorangegangenen, gefahrbegründenden Tun (Ingerenz) kann eine „wettbewerbsrechtliche Verkehrspflicht“ zum Handeln folgen.
VI. Der „ (unmittelbare und) objektive Zusammenhang“
182
Die geschäftliche Handlung setzt ein Verhalten voraus, „das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs … oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags … objektiv zusammenhängt“. Mit diesem Merkmal verfolgte der Gesetzgeber des UWG 2008[69] vor allem zwei Ziele: erstens die Ersetzung des subjektiven Elements der (Wettbewerbs-)Förderungsabsicht, das in den bisherigen Vorschriften (§ 1 UWG 1909: „zu Zwecken des Wettbewerbs“; § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 2004: „Wettbewerbshandlung“), enthalten war, durch ein objektives Kriterium; und zweitens die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des UWG auf Handlungen bei oder nach Vertragsschluss. Der RegE GSVW schlägt vor, die Formulierung in „unmittelbar und objektiv zusammenhängt“ zu ändern.[70]
1. Der (unmittelbare und) objektive Zusammenhang mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs
183
Das frühere Merkmal der Förderungsabsichtist entfallen, weil der Gesetzgeber der Ansicht war, ein „finaler Zurechnungszusammenhang“ sei mit Art. 2 lit. d UGP-RL kaum mehr zu vereinbaren.[71] Die Formulierung in Art. 2 lit. d UGP-RL („die unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung … zusammenhängt“) ist allerdings nicht eindeutig. Der Begriff „unmittelbar“ schließt es sprachlich nicht aus, den Zusammenhang auch in den Beweggründen des Handelnden zu finden. Andererseits war der Verzicht auf die Förderungsabsicht in vielen Fällen nicht spürbar, weil schon im früheren Recht in der Regel eine objektive Betrachtung vorherrschte. Die Förderungsabsicht wurde nämlich widerleglich vermutet, wenn Personen zugunsten des eigenen Unternehmens handelten und das Verhalten (objektiv) „geeignet“ war, „den Absatz oder Bezug … zu begünstigen“. Dies musste nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 2004 auch nicht mehr „zum Nachteil eines anderen“ geschehen, weil unlautere Handlungen von Monopolisten ebenfalls erfasst werden sollten.[72]
Читать дальше