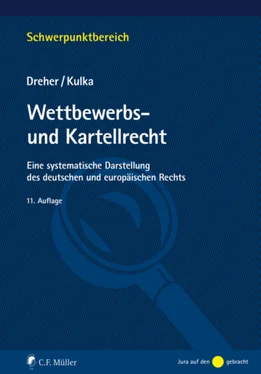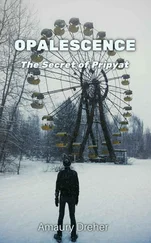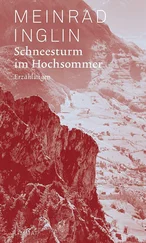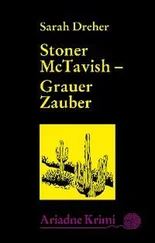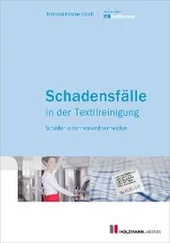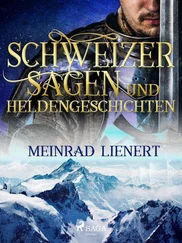B. Die geschäftliche Handlung (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 (Nr. 2 RegE) UWG)
165
Die Verbote des § 3 UWG richten sich – ebenso wie das Verbot des § 7 UWG – nur gegen „geschäftliche Handlungen“. Dieses Merkmal hat die „Wettbewerbshandlungen“ im UWG 2004 ersetzt und einige Änderungen gegenüber der früheren Rechtslage gebracht. Eine „geschäftliche Handlung“ ist nach der Definition in § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) „jedes Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem Geschäftsabschluss, das mit der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen oder mit dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen objektiv zusammenhängt“. Der Begriff wird auch in vielen Beispielstatbeständen verwendet, z. B. in § 4a Abs. 1, § 5 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 S. 1 UWG, während andere Tatbestände die betroffene Handlung konkreter umschreiben (vgl. z. B. § 4 oder § 7 Abs. 1 S. 2 UWG). Der „geschäftlichen Handlung“ entspricht in der UGP-RL der Begriff „Geschäftspraxis“ (sprachlich richtiger wäre wohl „Geschäftspra ktik “) oder „Geschäftspraktiken“ (vgl. Art. 2 lit. d, Art. 5 UGP-RL). Der BGH hat jedoch betont, dass § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) weiter reicht als der unionsrechtliche Begriff, weil dieser nur bestimmte Maßnahmen von Gewerbetreibenden gegenüber Verbrauchern betrifft, während jener umfassend Maßnahmen gegenüber allen Marktteilnehmern im Horizontal- oder Vertikalverhältnis erfasst.[16]
I. Die Abgrenzungsaufgaben des Merkmals
1. Handeln „im geschäftlichen Verkehr“
166
Die „geschäftliche Handlung“ darf nicht mit dem früheren Merkmal des Handelns „im geschäftlichen Verkehr“(§ 1 UWG 1909) verwechselt werden, das an anderer Stelle im Wettbewerbsrecht (vgl. § 16 Abs. 2 UWG, § 299 StGB) und im Markenrecht (vgl. z. B. § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 3 MarkenG) weiterverwendet wird. Dennoch hat der neue Begriff – ebenso wie bereits die „Wettbewerbshandlung“ des UWG 2004[17] – auch die Abgrenzungsaufgabe jenes Tatbestandsmerkmals übernommen. Im früheren Recht wurde durch das Merkmal „im geschäftlichen Verkehr“ klargestellt, dass Verbraucher bei der Deckung des privaten Bedarfs, Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei arbeitsrechtlich geregelten Tätigkeiten und die öffentliche Hand bei Ausübung hoheitlicher Befugnisse nicht dem UWG unterliegen.[18]
167
Diese Abgrenzungsaufgabe, die sich praktisch oft schon im Rahmen der Rechtswegfrage (§ 13 GVG, § 40 VwGO, § 2 ArbGG) stellt, muss auch heute noch gelöst werden. Der Gesetzgeber hat die Lösung freilich nicht erleichtert, weil das Merkmal des „geschäftlichen Verkehrs“ 2004 ohne jede Begründung aus der Generalklausel gestrichen wurde. Dessen ungeachtet hat der BGH bei der Anwendung von § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) an einem – ungeschriebenen – Tatbestandsmerkmal „im geschäftlichen Verkehr“ festgehalten.[19] Nach dem Wortlaut der Legaldefinition liegt es allerdings näher, die genannte Abgrenzung heute bei der Auslegung des Begriffs „Unternehmen“vorzunehmen und diesen wie im Kartellrecht funktional zu interpretieren ( Rdnr. 173 ff). Dann sind die Deckung des privaten Bedarfs, die Vornahme arbeitsrechtlich geregelter Handlungen und das Tätigwerden der öffentlichen Hand mit hoheitlichen Mitteln kein „Verhalten zugunsten … eines … Unternehmens“.
2. Abgrenzung vom allgemeinen Deliktsrecht
168
Das Merkmal der geschäftlichen Handlung dient vor allem dem Zweck, das Wettbewerbsrecht vom allgemeinen Deliktsrechtder §§ 823 ff BGB abzugrenzen.[20] Es übernimmt insofern auch die Aufgabe, die im UWG 1909 dem Handeln „zu Zwecken des Wettbewerbs“[21] und im UWG 2004 der „Wettbewerbshandlung“[22] zukam. Beide Merkmale wurden so verstanden, dass sie – objektiv – ein Verhalten voraussetzten, „das geeignet ist, den Absatz oder den Bezug einer Person … zu begünstigen“, und dass der Handelnde dabei – subjektiv – in der „Absicht“ vorgehen musste, „den eigenen oder einen fremden Wettbewerb … zu fördern“.[23]
169
Der Gesetzgeber hat dieser Abgrenzungsaufgabe bei den letzten Änderungen des UWG wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Er war bei der Novelle 2008 vor allem bemüht, Art. 2 lit. d UGP-RL („jede Handlung, …, die unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an Verbraucher zusammenhängt“) richtig umzusetzen. Diese Vorschrift setzt auf den ersten Blick keinen „finalen Zurechnungszusammenhang“ oder eine Wettbewerbsförderungsabsicht voraus.[24] Andererseits nötigt der „unmittelbare Zusammenhang“ der Richtlinie sprachlich nicht zu einer Beschränkung der Beurteilung auf die tatsächlichen Auswirkungen einer Handlung und zu einem völligen Verzicht auf subjektive Elemente. Maßgeblich ist lediglich eine objektive Bewertungder Handlung (vgl. Rdnr. 183 ff). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der deutsche Gesetzgeber jedenfalls „weltanschauliche, wissenschaftliche, redaktionelle oder verbraucherpolitische Äußerungen“ vom UWG ausnehmen wollte.[25]
3. Einbeziehung von Handlungen nach Vertragsschluss
170
Das Merkmal „geschäftliche Handlung“ dehnt schließlich den Anwendungsbereich des UWG auf Handlungen nach Vertragsschlussaus. Denn neben die „Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen“ treten Handlungen, die mit „dem Abschluss oder der Durchführung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen“ objektiv zusammenhängen. Darin liegt eine erhebliche Ausweitung des früheren Anwendungsbereichs des UWG. Die Regierungsbegründung des UWG 2004[26] ging noch davon aus, dass Gegenstand des UWG „nicht allgemein das Handeln eines Unternehmers im geschäftlichen Verkehr“ sei; vielmehr sei der Maßstab des Wettbewerbsrechts „nur an das marktbezogene Verhalten eines Unternehmers anzulegen“. Dagegen sah die Regierungsbegründung des UWG 2008[27] die Rechtsprechung als „überholt“ an, die aus dem Merkmal der Absatzförderung die Folgerung zog, der Wettbewerb sei im Regelfall mit dem Vertragsabschluss beendet. Die Hauptaufgabe besteht deshalb heute darin, die Reichweite der Art. 2 lit. d (der „unmittelbare Zusammenhang mit … dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts“) und Art. 5 Abs. 1 UGP-RL („nach Abschluss eines auf ein Produkt bezogenen Handelsgeschäfts“) zu bestimmen, die mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) umgesetzt werden.
II. Die handelnde „Person“
171
Der Adressat des in der Generalklausel enthaltenen Verbots wird vom Gesetz als „Person“ – und nicht wie im Kartellrecht als „Unternehmen“ – bezeichnet. Der Ausdruck „Person“ unterscheidet sich von den in § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 6 (Nr. 3, 4 und 8 RegE) , Abs. 2 UWG legaldefinierten Begriffen. Sprachlich ist es möglich, ihn auch auf juristische Personen zu erstrecken, nicht jedoch auf Personengesellschaften, die keine juristischen Personen sind (vgl. § 14 BGB). Es ist aber fraglich, ob § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) Personenvereinigungenüberhaupt einbeziehen will. Die Regierungsbegründungen geben, auch wenn es sich bei der „geschäftlichen Handlung“ um einen „Zentralbegriff“ des UWG handelt,[28] keinen Aufschluss. Viel spricht dafür, den Begriff auf natürliche Personen zu beschränken, weil das Wettbewerbsrecht Sonderdeliktsrecht ist und die Verantwortlichkeit der hinter den handelnden natürlichen Personen stehenden Unternehmensträger(gesellschaften) besonderer Zurechnungsvorschriften bedarf (z. B. § 8 Abs. 2 UWG, §§ 31, 831 BGB).[29]
Читать дальше