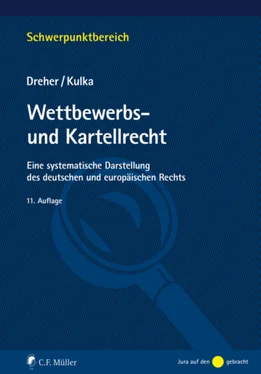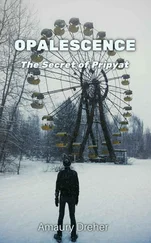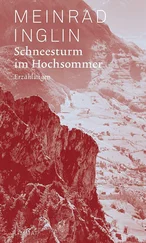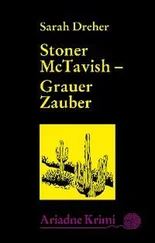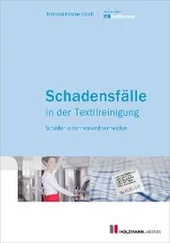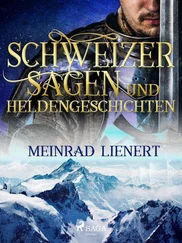157
Allerdings enthalten die §§ 3a bis 6 UWG viele Spezialtatbestände, die die Unlauterkeit für einzelne Fallgruppen konkretisieren. Daher ergibt sich für eine Fallbearbeitungfolgende Prüfungsreihenfolge: Nach (a) einem Blick auf das besondere Verbot unzumutbarer Belästigungen in § 7 UWG sind (b) zuerst die Per-se-Verbote des § 3 Abs. 3 UWG i. V. m. dem Anhang zu prüfen, (c) sodann § 3 Abs. 1 UWG i. V. m. den Spezialtatbeständen der Unlauterkeit in §§ 3a bis 6 UWG und (d) erst zum Schluss § 3 Abs. 1 UWG direkt, und zwar (aa) entweder in Verbindung mit § 3 Abs. 2 UWG bei Handlungen gegenüber Verbrauchern in dem durch die UGP-RL harmonisierten Bereich oder (bb) allein und selbstständig in allen übrigen Fällen.
II. Funktionen
158
Nach der Begründung des Rechtsausschusses des Bundestags soll § 3 Abs. 1 UWG 2015 zunächst eine „Rechtsfolgenregelung“ enthalten.[6] Allerdings geht es dabei nur um eine einzige Rechtsfolge, nämlich das grundsätzliche Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen („sind unzulässig“). Erst das mit dem Wort „Rechtsfolgen“ überschriebene Kapitel 2 des UWG enthält die zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen für Verstöße gegen das Verbot. Wichtiger ist daher, dass die neue Fassung die Anwendbarkeitder Generalklausel auch in dem EU-rechtlich harmonisierten Bereichder geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern klarstellt und damit den Meinungsstreit über das Verhältnis der Absätze 1 und 2 des § 3 UWG 2008 beendet. Auch im Verhältnis zu Verbrauchern ergibt sich das Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen als solches aus § 3 Abs. 1 UWG. Selbstständige Verbote enthalten darüber hinaus § 3 Abs. 3 und § 7 Abs. 1 S. 1 UWG.[7]
159
§ 3 Abs. 1 UWG enthält außerdem einen sehr weit gefassten Tatbestand: „Unlautere geschäftliche Handlungen …“. Eine solche Generalklausel ist im Wettbewerbsrecht sinnvoll, weil der Gesetzgeber nicht alle denkbaren Fälle unlauteren Verhaltens speziell erfassen kann. Allerdings hat sich das UWG mit der Zeit verändert und im Bereich der Fallgruppen zusätzliche Tatbestände von generalklauselartiger Weite erhalten (vgl. insbesondere § 3a, § 4 Nr. 4, § 4a Abs. 1, § 5 Abs. 1 S. 1 UWG (Abs. 1 RegE) ). Fälle, in denen direkt auf die Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG zurückgegriffen werden muss, sind daher nicht mehr allzu zahlreich.[8] Dennoch hat der Rechtsausschuss des Bundestags mit Recht betont, dass § 3 Abs. 1 UWG in dem nicht EU-rechtlich harmonisierten Bereich „wie bisher als Auffangtatbestand für solche geschäftlichen Handlungen dient, die von den nachfolgenden Bestimmungen nicht erfasst werden, aber einen vergleichbaren Unlauterkeitsgehalt aufweisen“.[9]
160
Im Verhältnis zu Verbrauchern übernimmt die Rolle des Auffangtatbestands § 3 Abs. 2 UWG 2015, der Art. 5 Abs. 2 UGP-RL umsetzt und das Merkmal „unlauter“ präzisiert. Auch Art. 5 Abs. 2 UGP-RL wird als Auffangtatbestand („safety net“)[10] verstanden, der Verhaltensweisen erfassen soll, die weder aggressiv noch irreführend sind und auch nicht in Anhang I UGP-RL aufgeführt werden. Der Maßstab der „unternehmerischen Sorgfalt“ (§ 3 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 7 UWG (Nr. 9 RegE) ) wird so zum entscheidenden Kriterium für alle nicht speziell geregelten Fälle der Unlauterkeit gegenüber Verbrauchern.[11] „The provision is also future proof as it allows for emerging unfair practices to be tackled.“[12]
3. Ermächtigung an den Richter
161
Durch die Generalklausel überträgt der Gesetzgeber außerdem den Gerichten die Aufgabe, den Maßstab des „Unanständigen“ bzw. des „unternehmerisch Unsorgfältigen“ im Einzelnen zu konkretisieren. Dieser Vorgang der Konkretisierungunterscheidet sich angesichts der Unbestimmtheit der Tatbestandsmerkmale beträchtlich von einer bloßen Subsumtion und ähnelt in vielem der Rechtssetzung. Je stärker allerdings Regelbeispiele, Anhänge und Fallmaterial anwachsen und je weiter die Gerichte bei der Ordnung der Materie voranschreiten, umso mehr verlagert sich der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit von der Setzung wettbewerbsrechtlicher Normen zur Subsumtion unter das selbstgeschaffene Richterrecht.
162
Von der Ermächtigung zur Setzung von Richterrechtdurch die wettbewerbsrechtliche Generalklausel haben die Gerichte in der Vergangenheit weitgehenden Gebrauch gemacht. So ist mit der Zeit jenes feingegliederte und doch elastische und praktikable Normengefüge des Wettbewerbsrechts entstanden, aus dem ein großer Teil der Beispielsfälle in §§ 3a ff UWG hervorgegangen ist und das in den nicht speziell geregelten Fällen auch weiterhin die Anwendung der Generalklausel leitet. Die Arbeit mit Präjudizien ist im Wettbewerbsrecht alltäglich und ähnelt in vielem der Tätigkeit anglo-amerikanischer Gerichte bei Anwendung des einschlägigen case law. Der tragende Grund der wettbewerbsrechtlichen Entscheidung unter dem UWG blieb freilich stets das Gesetz.
163
Durch die Kodifizierung der speziellen Tatbestände in §§ 3a ff UWG und im Anhang ist die Ermächtigung zur Setzung weiteren, neuen Richterrechts nicht obsolet geworden. Nach der Regierungsbegründung zum UWG 2004[13] soll die Generalklausel dem Rechtsanwender die Möglichkeit geben, „ neuartige Wettbewerbsmaßnahmensachgerecht zu beurteilen“. Zudem könne durch die Generalklausel „den sich wandelnden Anschauungen und Wertmaßstäbenin der Gesellschaft besser Rechnung getragen werden“. Dabei ist nur zu beachten, dass die nationalen Gerichte die Konkretisierungsbefugnis bei Handlungen gegenüber Verbrauchern wegen der Vollharmonisierung durch die UGP-RL mit dem EuGH teilen müssen.
4. Verfassungs- und EU-konforme Anwendung
164
Generalklauseln ermöglichen schließlich die bruchlose Einbeziehungverfassungs- und EU-rechtlicher Maßstäbe in die wettbewerbsrechtliche Beurteilung. Die Drittwirkung der Grundrechte (vgl. dazu Rdnr. 116) kann sich – soweit erforderlich – im Zivilrecht nur im Rahmen von Generalklauseln entfalten.[14] In gleicher Weise öffnen die Generalklauseln das deutsche Recht für die Vorgaben des EU-Rechts (vgl. dazu Rdnr. 73 ff). Sie würden es auch ermöglichen, den Harmonisierungsprozess im Wege von Einzelfallentscheidungen flexibel zu gestalten und Anpassungsmaßnahmen in den starren Formen des Gesetzes zu vermeiden. Leider vertritt jedoch der EuGH die Ansicht, dass eine Rechtsprechung, die innerstaatliche Rechtsvorschriften in einem Sinne auslegt, der den Anforderungen einer Richtlinie entspricht, für sich allein nicht dem Erfordernis der Rechtssicherheit genügt.[15] Daher musste auch in Deutschland der Gesetzgeber die Aufgabe der Anpassung des nationalen Rechts an das EU-Recht übernehmen. Die wenig gelungene Umsetzung der UGP-RL in mehreren Anläufen wirft jedoch die Frage auf, ob nicht der Weg einer sukzessiven Harmonisierung des Wettbewerbsrechts durch EU-konforme Anwendung der Generalklausel durch die Gerichte der bessere Weg gewesen wäre.
Merke: Die Generalklausel des § 3 Abs. 1 UWG
§ 3 Abs. 1 UWG enthält das zentrale Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen. Das Merkmal der Unlauterkeit besteht aus zwei Elementen: der Unanständigkeit der Handlung und dem Erheblichkeits- und Spürbarkeitskriterium. Letzteres entfällt in den in § 3 Abs. 3 UWG geregelten Fällen. Die Unlauterkeit wird in den §§ 3a bis 6 UWG für besondere Fallgruppen und in § 3 Abs. 2 für Handlungen gegenüber Verbrauchern allgemein konkretisiert. Darüber hinaus ist § 3 Abs. 1 UWG Auffangtatbestand und Ermächtigung an den Richter, nicht speziell geregelte und neuartige Wettbewerbshandlungen angemessen zu beurteilen.
Читать дальше