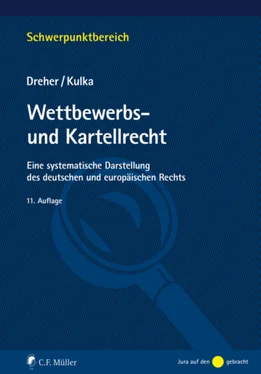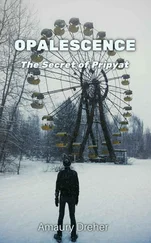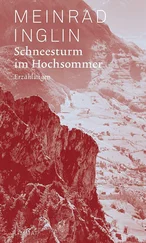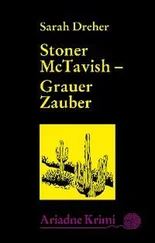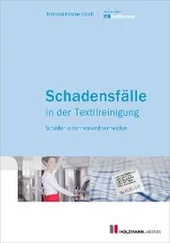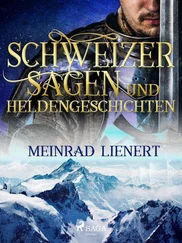III. Kein subjektiver Tatbestand
215
§ 3 Abs. 1 UWG weist ausdrücklich kein subjektives Tatbestandsmerkmal auf. Dagegen enthalten einige der Beispielsfälle subjektive Tatbestandselemente, z. B. § 4a Abs. 2 S. 1 Nr. 3 UWG („bewusste Ausnutzung“). Darüber hinaus ist für den Anspruch auf Schadensersatz aus § 9 UWG – und den ihn vorbereitenden Auskunftsanspruch – Vorsatz oder Fahrlässigkeit, für den Anspruch auf Gewinnabschöpfung aus § 10 UWG Vorsatz erforderlich. Praktisch ist die Frage nach dem subjektiven Tatbestand daher nur für den Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruchaus § 8 Abs. 1 UWG von Bedeutung.
216
Freilich setzt der zivilrechtliche Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch kein Verschulden voraus. Für das UWG 1909 wurde aber von der herrschenden Meinung vom Handelnden die Kenntnis aller Tatumstände, besonders derjenigen, die die Sittenwidrigkeit begründeten, verlangt.[133] Dabei sollte es genügen, dass er mit der Möglichkeit des Vorliegens der Tatumstände rechnete oder sich der Kenntnis bewusst entzog. Eine fahrlässige, auch grob fahrlässige Unkenntnis reichte dagegen nicht aus. An dieser herrschenden Meinung gab es jedoch auch Kritik.[134]
217
Der Gesetzgeberdes UWG 2004 verzichtete bewusst darauf, den Streit zu schlichten, und überließ die Klärung Rechtsprechung und Literatur, da es sich „um eine dogmatische Frage“ handele.[135] Er wies jedoch zu Recht darauf hin, dass die praktische Relevanzdes Streits gering war, weil der Zuwiderhandelnde Kenntnis von den Umständen spätestens mit Zugang der Abmahnung erhält. Setzt er daraufhin sein Verhalten fort, ist der Unterlassungsanspruch unproblematisch gegeben. Stellt er sein Verhalten ein, fehlt es an der für den Unterlassungsanspruch erforderlichen Wiederholungsgefahr.
218
Für das heutige UWG gehen Rechtsprechung[136] und Literatur[137] davon aus, dass auf das Erfordernis der Kenntnis von den Tatumständen verzichtet werden muss. Das ist auch mit Blick auf die Abmahnunggem. § 13 UWG gerechtfertigt. Hier besteht der Anspruch auf Aufwendungsersatz gem. § 13 Abs. 3 UWG nur, „soweit die Abmahnung berechtigt ist“. Würde man die „Berechtigung“ der Abmahnung von der Kenntnis des Abgemahnten abhängig machen, so bestünde wohl oft die Gefahr, dass der Verletzte im Fall einer nur objektiv berechtigten Abmahnung seine Kosten nicht erstattet erhielte.
Merke: Feststellung der Unlauterkeit im Sinn von § 3 Abs. 1 UWG
Die Unlauterkeit einer geschäftlichen Handlung ergibt sich weder empirisch aus den Sitten und Gebräuchen der betroffenen Verkehrskreise noch aus den Absichten und Motiven des Handelnden – der Tatbestand des § 3 Abs. 1 UWG enthält kein subjektives Merkmal. Sie ist vielmehr objektiv durch eine Bewertung aller Umstände des Einzelfalls (und nicht durch Interessenabwägung) festzustellen. Maßstab der Bewertung in nicht speziell geregelten Fällen sind vor allem die aus §§ 3a ff UWG ersichtlichen Grundentscheidungen des Gesetzgebers, die gleichberechtigten Schutzzwecke des § 1 UWG, die Grundrechte in ihrer Drittwirkung und die einschlägigen Normen des EU-Rechts. Als ungeschriebenes Merkmal der Unlauterkeit zur Ausgrenzung von Bagatellfällen kommt hinzu, dass die Handlung für den Wettbewerb erheblich (relevant) und die in Frage kommende Beeinträchtigung von Marktteilnehmern spürbar sein muss.
D. Der Tatbestand des § 3 Abs. 2 UWG
219
In der Fassung des UWG 2015bestimmt § 3 Abs. 2 UWG, dass geschäftliche Handlungen, „die sich an Verbraucher richten oder diese erreichen“, unlauter sind, „wenn sie nicht der unternehmerischen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen“. Die „unternehmerische Sorgfalt“ wird in § 2 Abs. 1 Nr. 7 UWG (Nr. 9 RegE) legaldefiniert, die „wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers“ in § 2 Abs. 1 Nr. 8 UWG (Nr. 11 RegE) und – letztere ergänzend – die „geschäftliche Entscheidung“ in § 2 Abs. 1 Nr. 9 UWG (Nr. 1 RegE) . § 3 Abs. 2 UWG enthält keine Rechtsfolge, ist aber – ähnlich wie § 3 Abs. 1 UWG – in dem unionsrechtlich harmonisierten Bereich zugleich Auffangtatbestand, Ermächtigung der Gerichte zur Konkretisierung und Fortbildung des Wettbewerbsrechts in nicht speziell geregelten Fällen und Grundlage für eine verfassungs- und unionskonforme Rechtsanwendung (vgl. Rdnr. 158 ff).
220
§ 3 Abs. 2 UWG dient der Umsetzung von Art. 5 Abs. 2 UGP-RL. Wie die erst 2008 in das UWG eingefügte Vorgängervorschrift[138] betrifft er nur geschäftliche Handlungen gegenüber Verbrauchern. Von § 3 Abs. 2 UWG 2008 unterscheidetsich § 3 Abs. 2 UWG 2015 in mehrfacher Hinsicht: Zunächst enthält er nur noch einen Satz, und die früheren Sätze 2 und 3 finden sich heute in § 3 Abs. 4 UWG. Sodann ist die Vorschrift nicht mehr als Verbot formuliert, sondern als Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals „unlauter“. Des Weiteren ist die „fachliche“ Sorgfalt in „unternehmerische“ Sorgfalt umbenannt worden, die Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 7 UWG (Nr. 9 RegE) aber nur wenig – nämlich durch Hinzufügung des Worts „anständigen“ zu den „Marktgepflogenheiten“ – geändert worden. Schließlich ist der Wortlaut einerseits dem Text des Art. 5 Abs. 2 UGP-RL angeglichen worden, andererseits um die Passagen, die nunmehr in den Legaldefinitionen des § 2 Abs. 1 Nr. 8 und 9 UWG (Nr. 1 und 11 RegE) enthalten sind und Art. 2 lit. e und k UGP-RL umsetzen, entlastet worden.
221
In ihrer Grundstrukturentspricht die in § 3 Abs. 2 UWG geregelte Unlauterkeit[139] derjenigen in § 3 Abs. 1 UWG. Sie setzt sich auch hier aus dem Unrechtstatbestand und einem Relevanz- und Spürbarkeitserfordernis zusammen, das in einer besonderen Eignungsklausel enthalten ist. Der Unrechtstatbestandbesteht darin, dass die geschäftliche Handlung „nicht der unternehmerischen Sorgfalt entspricht“. Nach der Eignungsklauselist eine solche Handlung nur dann unlauter, „wenn sie dazu geeignet ist, das wirtschaftliche Verhalten des Verbrauchers wesentlich zu beeinflussen“. Die „wesentliche Beeinflussung“ wiederum setzt nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Nr. 8 UWG (Nr. 11 RegE) eine erhebliche und spürbare Beeinträchtigung der Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte Entscheidung zu treffen, voraus.
II. Der Verstoß gegen die „unternehmerische Sorgfalt“
222
Das Unrecht geschäftlicher Handlungen ergibt sich im Fall von § 3 Abs. 2 UWG aus einem Verstoß gegen die „unternehmerische Sorgfalt“. Dabei handelt es sich um den „Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise angenommen werden kann, dass ein Unternehmer ihn in seinem Tätigkeitsbereich gegenüber Verbrauchern nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der anständigen Marktgepflogenheiten einhält“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 UWG (Nr. 9 RegE) ). Diese Häufung unbestimmter Rechtsbegriffe ist mit dem Zweck einer Legaldefinition, Rechtssicherheit zu schaffen, kaum zu vereinbaren. Sie entspricht aber der hier umgesetzten Definition der „beruflichen Sorgfalt“ in Art. 2 lit. h UGP-RL. Mit der Abkehr von dem unionsrechtlichen Begriff „berufliche“ Sorgfalt korrigiert der deutsche Gesetzgeber richtigerweise die unzureichende deutsche Übersetzung der in der englischen („professional diligence“) und französischen („diligence professionnelle“) Fassung der Richtlinie verwendeten Begriffe.
223
Die Regierungsbegründungerwartete seinerzeit bei der Einfügung von § 3 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 7 (Nr. 9 RegE) in das UWG 2008 keine wesentlichen Änderungen gegenüber der zuvor bestehenden Rechtslage.[140] Diese Erwartung hat sich in gewisser Weise erfüllt; denn § 3 Abs. 2 UWG 2008 hat neben den besonderen Tatbeständen der Unlauterkeit in §§ 3a ff UWG in der Praxis keine große Rolle gespielt. Auch im Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen zur UGP-RL[141] finden sich diesbezüglich kaum Hinweise.[142] Immerhin haben die deutschen Gerichte in Fällen der Wertreklame bzw. des „übertriebenen Anlockens“, die in der UGP-RL wenig Beachtung gefunden haben, gelegentlich einen Sorgfaltsverstoß im Sinn von § 3 Abs. 2 UWG geprüft.[143]
Читать дальше