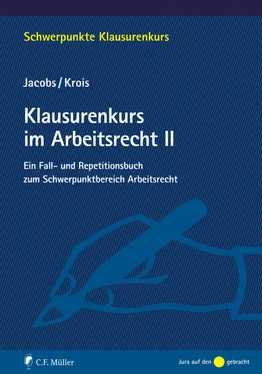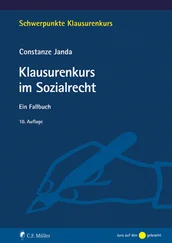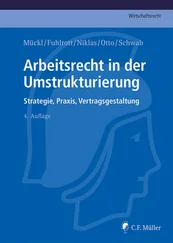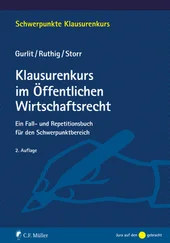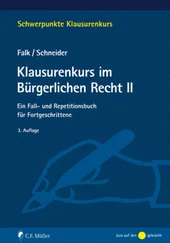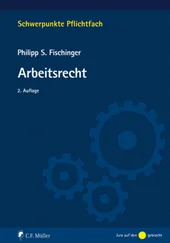1 ...7 8 9 11 12 13 ...24
2. An sich geeigneter Kündigungsgrund
80
Zur sozialen Rechtfertigung der Kündigung muss gem. § 1 II 1 KSchGzunächst ein Kündigungsgrund vorliegen. In Betracht kommt allein ein verhaltensbedingterKündigungsgrund.[27] Ein verhaltensbedingter Grund erfordert, dass der Arbeitnehmer durch das ihm vorgeworfene Verhalten eine Haupt- oder Nebenpflicht steuerbar, d.h. vorwerfbar und damit schuldhaft, erheblich verletzt.[28]
81
Die private Internetnutzung stellt somit einen verhaltensbedingten Kündigungsgrund „an sich“ dar, wenn der Arbeitnehmer entweder seine Arbeitsleistung nicht erbringt (Verletzung der Hauptleistungspflicht) oder durch sie eine vertragliche Nebenpflicht verletzt.[29] Auf seine Arbeitsleistung haben die Downloads des A keinerlei negative Auswirkungen, so dass eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflichtausscheidet. Eine Nebenpflichtverletzungdadurch, dass A mit den Downloads besondere Kosten verursacht hätte, ist – abgesehen von denkbaren, aber nicht bezifferten Imageschäden bei Kunden – ebenfalls nicht ersichtlich. Allerdings hat A erhebliche Mengen von Daten auf betriebliche Systeme heruntergeladen und diese damit in ihrer Funktionsfähigkeit gefährdet. Damit hat er seine Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechtsgüter und Interessen seines Arbeitgebers verletzt (vgl. § 241 II BGB). Ein verhaltensbedingter Kündigungsgrund „an sich“ liegt mithin vor.[30]
82
Wiederholung und Vertiefung:
Das BAG differenziert zwischen drei Konstellationen, in denen bei privater Internetnutzung„an sich“ ein verhaltensbedingter Kündigungsgrund gegeben ist.[31] Das gilt unabhängig von der Frage, ob der Arbeitgeber die private Internetnutzung ausdrücklich und konsequent untersagt oder (teilweise) gestattet hat (s. dazu noch ausführlich Rn. 96).
| (1) |
Nichterbringung der arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung, weil der Arbeitnehmer während der Arbeitszeit im Internet surft oder den Computer nutzt (Hauptpflichtverletzung). |
| (2) |
Herunterladen erheblicher Mengen von Daten auf betriebliche Datensysteme, insbesondere wenn damit die Gefahr möglicher Vireninfizierungen oder anderer Störungen des Betriebssystems verbunden sein kann (Nebenpflichtverletzung). |
| (3) |
Entstehen besonderer Kostenfür den Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer die Betriebsmittel unberechtigterweise in Anspruch genommen hat (Nebenpflichtverletzung). |
Eine detaillierte Kenntnis der Fallgruppen wurde von den Bearbeitern der Klausur zwar nicht erwartet, wohl aber die Differenzierung zwischen verschiedenen (möglichen) Arten privater Internetnutzung und ihre Zuordnung zu zulässigem und unzulässigem Verhalten.
83
Weiterhin muss das in der Vergangenheit gezeigte Verhalten des A eine Störung in der Zukunft nahe liegen lassen (negative Prognose), damit es seiner „ Weiterbeschäftigung“ i.S.d. § 1 II 1 KSchGentgegensteht.[32] Erforderlich ist daher entweder eine Wiederholungsgefahr oder eine so schwerwiegende Störung, dass sie eine gedeihliche Zusammenarbeit in der Zukunft nicht mehr möglich erscheinen lässt. A hat mehrmals und sogar nach entsprechender Aufforderung, dies zu unterlassen,[33] Downloads durchgeführt, so dass Wiederholungsgefahr und folglich eine negative Prognose für die Zukunft gegeben sind.
4. Ultima-ratio- Grundsatz
84
Darüber hinaus dürfen dem Arbeitgeber keine anderen, geeigneten Mittel als die Kündigung zur Verfügung stehen, um künftige Vertragsstörungen zu verhindern (sog. ultima-ratio -Grundsatz, vgl. § 1 II 2 u. 3 KSchG sowie § 2 II 2 Nr. 2 SGB III).[34] In Betracht kommt, dass P den A vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung zunächst hätte abmahnenmüssen. Möglicherweise ist eine solche Abmahnung aber bereits im Januar 2007 im Rahmen des Personalgesprächs erfolgt.
85
Die Abmahnung bedarf als geschäftsähnliche Handlung keiner besonderen Form,[35] so dass die mündliche Erklärung im Personalgespräch grds. genügt.[36]
86
Als Mittel zur Verhinderung künftiger Vertragsstörungen muss eine Abmahnung Hinweis-, Ermahnungs- und Warnfunktionfür den Arbeitnehmer erfüllen und daher eine Darstellung des vertragswidrigen Verhaltens, eine Rüge dieses Verhaltens als vertragswidrig, die Aufforderung zu vertragstreuem Verhalten in der Zukunft sowie die Drohung mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen beinhalten.[37] Im Gespräch mit A wurde zwar die Vornahme der Downloads als vertragswidriges Verhalten gerügt und A zu vertragstreuem Verhalten in der Zukunft aufgefordert, es erging aber kein Hinweis auf arbeitsrechtliche Konsequenzen.[38] Eine wirksame Abmahnung als milderes Mittel zur Kündigung ist damit vor dem Ausspruch der Kündigung nicht erfolgt.
c) Generelle Erforderlichkeit der Abmahnung
87
Wiederholung und Vertiefung:
Die Begriffe „Erforderlichkeit“ und „Entbehrlichkeit“ der Abmahnung werden in der Literatur teilweise nicht deutlich auseinander gehalten. Überwiegend – und auch hier – wird „Erforderlichkeit“ generell, „Entbehrlichkeit“ dagegen einzelfallbezogen verstanden.
88
Zunächst stellt sich die Frage, ob für Kündigungen im Vertrauensbereich eine Abmahnung überhaupt erforderlich ist. In seiner früheren Rechtsprechung differenzierte das BAG zwischen Störungen im Leistungs- und im Vertrauensbereich; bei Störungen im Vertrauensbereich sei keine Abmahnung erforderlich, da man einmal verlorenes Vertrauen durch eine Abmahnung nicht wiederherstellen könne.[39] Danach wäre eine vorherige Abmahnung durch P nicht erforderlich gewesen.
89
Dagegen spricht aber, dass bei Vertrauensstörungen durch steuerbares Verhalten eine Wiederherstellung dieses Vertrauens durch späteres ordnungsgemäßes Verhaltenmöglich ist.[40] Das BAG hat diese Einschränkung daher zu Recht aufgegeben.[41] Das Abmahnungserfordernis ist somit bei jeder verhaltensbedingten Kündigung und damit auch für die Kündigung des A einschlägig.
d) Entbehrlichkeit der Abmahnung im vorliegenden Fall
90
Die Abmahnung könnte aber ausnahmsweise entbehrlichgewesen sein. Entbehrlich ist eine Abmahnung, wenn aufgrund objektiver Umstände die an sich mögliche Verhaltensänderung in der Zukunft nicht zu erwartenist (vgl. §§ 314 II 2, 323 II BGB).[42]
91
Das ist insbesondere bei schweren Vertragsverletzungender Fall, bei denen der Arbeitnehmer erkennen musste, dass sie – auch ohne Abmahnung – zur Kündigung führen können, weil die Hinnahme des Verhaltens durch den Arbeitgeber offensichtlich ausgeschlossen ist.[43] Grds. waren die Downloads keinebesonders schwerwiegende Vertragsverletzung. Sie haben die betrieblichen Abläufe bei P jedenfalls nicht messbar und nur vorübergehend beeinträchtigt. Außerdem waren sie weder exzessiv[44] noch handelte es sich um „sittenwidrige“ oder „anstößige“, z.B. pornographische Downloads. Möglicherweise ist im Personalgespräch aber ein ausdrückliches Verbotausgesprochen worden, das den erneuten Download aus dem Internet zu einer schweren Vertragsverletzung macht.[45]
92
Dagegen spricht jedoch bereits die unklare Formulierungder Anweisung im Rahmen des Personalgesprächs, bei dem das Verbot auf einen Download in „derart großem Umfang“ relativiert wurde. Streng genommen hat A dieses Verbot sogar berücksichtigt, war der zweite Download doch um 40% weniger umfangreich als der vorherige. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass die Downloads – wenngleich in geringerem Umfang – seit 2002 zunächst beanstandungslos geduldetwurden. Schließlich würde das Erfordernis der Abmahnung im Ergebnis unterlaufen, wenn man in einer „fehlgeschlagenen“ Abmahnung ohne Weiteres ein ausdrückliches Verbot erblickte, das stets die Möglichkeit zur Kündigung ohne vorherige Abmahnung eröffnet. Eine Abmahnung war somit auch nicht entbehrlich, so dass die Kündigung des P gegen den ultima-ratio- Grundsatzverstößt.
Читать дальше