• Dass die Befriedigung der jeweils ›unteren‹ Bedürfnisse die Voraussetzung für die ›oberen‹ Bedürfnisse ist, gilt nach ›oben‹ zu immer weniger.
• Die von ›unten‹ nach ›oben‹ gestaffelte Dringlichkeit der Bedürfnisse gilt nicht notwendig in jedem Hier und Jetzt, sondern auf Dauer und im Allgemeinen.
• Die gestaffelte Dringlichkeit hängt auch von der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur, der Kultur, dem Milieu und der konkreten Situation ab.
• Trotz der zunehmenden Unterscheidung von Bedürfnistypen zeigen sich in der Anwendung auf unterschiedliche Gruppen von Betroffenen (wie psychisch oder körperlich Behinderte, Kinder, Jugendliche, Migranten und Migrantinnen usw.) große qualitative Unterschiede, die in der interaktiven Praxis zu berücksichtigen sind.
Nun steht hier nicht der empirische Status der Maslow’schen Annahmen zur Diskussion, also etwa Fragen, welche Bedürfnisse unter welchen Bedingungen zu welchem Verhalten motivieren. Vielmehr geht es darum, welche Befriedigungsmöglichkeiten von Bedürfnissen Anderer von uns nach ethischen Kriterien vorrangig zu berücksichtigen oder zu fördern sind. Damit gehen wir über die psychologische Ebene der Beschreibung und Erklärung hinaus und bringen die Gesichtspunkte der Rechtfertigung der Bedürfnisbefriedigung ins Spiel. Der Mensch hängt ja nicht gleichsam als eine Marionette an Fäden, die von den natürlichen Bedürfnissen bewegt werden, vielmehr kann er auch – jedenfalls zu einem gewissen Grad – auswählen, welche Bedürfnisse er auf welche Weise befriedigt und welche nicht. Nicht alle Bedürfnisse, und seien sie anthropologisch und psychologisch noch so grundlegend, stellen professionsethisch gerechtfertigte Werte und damit Handlungsziele dar. Dennoch kann als allgemeine Richtlinie formuliert werden, dass der jeweils dringlichere Wert – dieser resultiert zumeist aus einem »Mangelbedürfnis« – einem ranghöheren Wert – der entspricht den »Wachstumsbedürfnissen« – vorzuziehen ist. Dabei ist es, ethisch gesehen, ein entscheidender Unterschied, ob wir selbst unsere elementaren physio-psycho-sozialen Bedürfnisse zugunsten unserer Selbstverwirklichung einschränken oder ob wir das Anderen zumuten.
Ein Beispiel für den Vorrang der jeweils unteren gegenüber den jeweils höheren Bedürfnissen ist der im ersten Kapitel aufgeführte Fall des »Schüttelbabys«. Das staatliche »Wächteramt« gegenüber den Eltern dient hier der Sicherung der grundlegenden Bedürfnisse des hilflosen, zu seinem Überleben auf Hilfe angewiesenen Kindes, wobei die Selbstverwirklichungsbedürfnisse der Eltern, die auch in ihrem Recht auf Erziehung abgesichert sind, gegebenenfalls zurückstehen müssen. Ein anderes Beispiel ist das Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Fürsorge. Menschen, die ihre Autonomie noch nicht oder nicht mehr im vollen Umfang wahrnehmen können wie zum Beispiel Kinder, psychisch oder geistig Behinderte, Kranke, Demente müssen kompensatorisch versorgt werden. Wenn dabei die physische und materielle Versorgung gesichert werden muss, müssen demgegenüber unter Umständen selbstbestimmte Individualbedürfnisse zurückstehen.
Um Ziele zu erreichen, muss man sich für bestimmte Mittel bzw. Maßnahmen entscheiden, wobei oft mehrere Mittel zur Wahl stehen, zwischen denen auszuwählen ist. Die Rationalität des Einsatzes von Mitteln im Verhältnis allein zu einem vorgegebenen Ziel bemisst sich nach zwei Kriterien: des Nutzens und des Aufwands. In der Handlungstheorie, insbesondere in der Wirtschaftswissenschaft, werden diese als »Effektivität« und »Effizienz« bezeichnet. Entsprechend ist zu fragen: »Tun wir die richtigen Dinge?« Und: »Tun wir die Dinge richtig?« (Pepels 2002, 84). Diese Formel sollte aber nicht betriebswirtschaftlich eingeengt werden, sondern auf ihren ursprünglich ethischen Sinn hin erweitert werden (  Kap. 9). Mittel sind nicht nur an vorgegebenen Zielen zu messen, wie der bekannte, ja berüchtigte Satz »Der Zweck heiligt die Mittel« behauptet, sondern auch an ihrer ethischen Verträglichkeit im gesamten Handlungszusammenhang auszurichten. So fragwürdig der Satz als normativer ist, so zutreffend mag er als deskriptiver sein. In diesem letzteren Sinn war er wohl von seinem angeblichen Urheber Nicolò Machiavelli (1469-1527) gemeint, der ihn als einen Grundzug der Politik ansah.
Kap. 9). Mittel sind nicht nur an vorgegebenen Zielen zu messen, wie der bekannte, ja berüchtigte Satz »Der Zweck heiligt die Mittel« behauptet, sondern auch an ihrer ethischen Verträglichkeit im gesamten Handlungszusammenhang auszurichten. So fragwürdig der Satz als normativer ist, so zutreffend mag er als deskriptiver sein. In diesem letzteren Sinn war er wohl von seinem angeblichen Urheber Nicolò Machiavelli (1469-1527) gemeint, der ihn als einen Grundzug der Politik ansah.
Das im Alltagsbewusstsein präsente Problem der »Risiken und Nebenfolgen« von Arzneimitteln tritt analog auch bei den fachlichen Interventionen der Sozialen Arbeit auf, nur dass kein »Arzt oder Apotheker«, sondern nur die eigene Fachlichkeit zu befragen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zu erwartenden, erwünschten Folgen einer Maßnahme durch damit vielleicht verbundene, unerwünschte Folgen zunichte gemacht werden könnten. Genauer betrachtet spielt in der Abwägung aber noch ein weiterer Gesichtspunkt eine Rolle, nämlich ein alternatives Handeln, das auch ein Nicht-Handeln, d. h. die Vermeidung oder Rücknahme einer Maßnahme sein kann. Auch dieses hat Folgen und möglichweise unerwünschte Nebenfolgen. Daraus ergibt sich das abgebildete Entscheidungsschema (  Abb. 3).
Abb. 3).

Abb. 3: Entscheidungsstruktur hinsichtlich Folgen und Nebenfolgen
Besonders schwierig erscheinen Entscheidungen dann, wenn alle zu erwartenden Nebenfolgen der zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen nachteilig sind, so dass weniger zwischen Gut und Übel als zwischen geringerem und größerem Übel abzuwägen ist. Dabei bedarf die Entscheidung der komplexen Abwägung zwischen den unterschiedlichen Zielen und Nebenfolgen, insbesondere zwischen den Folgen und Nebenfolgen der geplanten Handlung und denen ihrer Unterlassung,
Anders als die voranstehende Abbildung suggerieren könnte, darf man sich die Ziele und ihre Alternativen, die Folgen und Nebenfolgen nicht als ein für alle Mal gegeben vorstellen. Man muss bei dem Schema sozusagen noch eine zeitliche, dynamische Dimension hinzudenken. Ob Ziele tatsächlich erreicht werden, hängt wesentlich vom Zusammenwirken aller Beteiligten ab, und unerwünschte, aber unvermeidliche Nebenfolgen lassen sich durch weitere Maßnahmen mildern. Ethische Verantwortung lässt sich letztlich weniger durch einen »Entscheidungsbaum« vorstellen, in dem die Ergebnisse hierarchischer Entscheidungen geordnet werden (wie in Technik und Ökonomie geläufig), vielmehr als »Rückkopplungsschleife«: Jede erreichte Handlungsfolge wirkt auf die Ausgangsbedingungen zurück und verändert so die Gesamtkonstellation. In diesem Sinne muss das Zusammenwirken von Motiv, Ziel, Mittel und Folge einer Handlung prozessual verstanden werden.
2.4 Die Balance der Werte
Eine Analyse ethischer Spannungsfelder findet sich ansatzweise schon in der Ethik des Aristoteles aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Sie wurde im 20. Jahrhundert in der philosophischen Wertethik wieder aufgegriffen und erweitert. In dieser Tradition werden Tugenden bzw. Werte nicht als statische Größen angesehen, sondern sind je nach Situation graduell zu bestimmen, und zwar nach zwei Dimensionen:
• Zunächst gibt es ein Mehr oder Weniger an Intensität der Tugend, und jede Situation hat ihr angemessenes Maß. Ein Beispiel ist das Schenken. Sein Null-Wert ist das Nicht-Schenken. Der angemessene Wert eines Geschenks hängt vom Anlass und der Beziehung der Beteiligten und den Ressourcen des Schenkenden ab.
Читать дальше
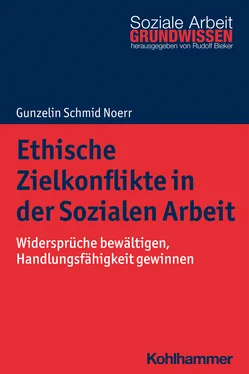
 Kap. 9). Mittel sind nicht nur an vorgegebenen Zielen zu messen, wie der bekannte, ja berüchtigte Satz »Der Zweck heiligt die Mittel« behauptet, sondern auch an ihrer ethischen Verträglichkeit im gesamten Handlungszusammenhang auszurichten. So fragwürdig der Satz als normativer ist, so zutreffend mag er als deskriptiver sein. In diesem letzteren Sinn war er wohl von seinem angeblichen Urheber Nicolò Machiavelli (1469-1527) gemeint, der ihn als einen Grundzug der Politik ansah.
Kap. 9). Mittel sind nicht nur an vorgegebenen Zielen zu messen, wie der bekannte, ja berüchtigte Satz »Der Zweck heiligt die Mittel« behauptet, sondern auch an ihrer ethischen Verträglichkeit im gesamten Handlungszusammenhang auszurichten. So fragwürdig der Satz als normativer ist, so zutreffend mag er als deskriptiver sein. In diesem letzteren Sinn war er wohl von seinem angeblichen Urheber Nicolò Machiavelli (1469-1527) gemeint, der ihn als einen Grundzug der Politik ansah.











