Doch es sind nicht nur die individuellen Faktoren, die eine Rolle spielen, sondern es existieren auch sehr starke Zusammenhänge zwischen dem sozialen Hintergrund und der akademischen Entwicklung. Etwa 80 % bis 90 % der als lernbehindert eingestuften Kinder stammen aus stark unterprivilegierten sozialen Milieus (Klauer & Lauth, 1997) und auch das Risiko der Entwicklung einer Lernbehinderung ist bei Zugehörigkeit zu diesen Sozialschichten stark erhöht. Neben genetischen Einflussfaktoren und der Wechselwirkung von Genen und Umwelt ergeben sich für diese Familien Schwierigkeiten in der Passung zwischen dem eigenen Bildungsweg und dem Werdegang der Kinder. Eltern, die selbst keine höhere Bildungslaufbahn durchlaufen haben, finden selbst nur schwer Zugang zu akademischen Settings und können ihre Kinder nicht in dem Maße auf ein Studium vorbereiten wie Eltern mit akademischem Hintergrund. Die betreffenden Kinder erfahren weniger Unterstützung im Sinne einer Propagierung hoher Leistungsziele, der Wertschätzung schulischen Erfolgs, der Anregung und Gewährung von Selbstständigkeit und der Unterstützung in schulischen Belangen. Den Eltern fällt es schwer, eine bildungsaffine häusliche Lernumgebung zur Verfügung zu stellen, entstehende Leistungsschwierigkeiten zu erkennen und ihren Kindern zu helfen. In PISA 2015 (Müller & Ehmke, 2016) klärte der soziale Hintergrund 13 % der interindividuellen Leistungsvarianz naturwissenschaftlicher Kompetenzen auf, ein Wert, der dem sogenannten sozialen Gradienten in der Lesekompetenz entspricht und der als großer Effekt bezeichnet werden kann (  Abb. 2.2).
Abb. 2.2).



Und nicht zuletzt stehen die verschiedenen Risikofaktoren nicht isoliert nebeneinander, sondern sie interagieren miteinander. Zeskind und Ramey (1981) führten eine Interventionsstudie bei Kindern sozioökonomisch benachteiligter Familien durch, von denen ein Teil der Kinder ein zusätzliches biologisches Risiko hatte (Frühgeburt, medizinische Komplikationen, fötale Unterernährung, Verzögerung der mentalen Entwicklung etc.). Im Alter von 24 Monaten wurden die Kinder hinsichtlich ihrer kognitiven Fähigkeiten mit dem Stanford-Binet-Intelligenztest untersucht und 50 Wochen lang in einer Kindertagesstätte fünfmal in der Woche gefördert. Zusätzlich erhielten die Kinder medizinische Unterstützung und Verpflegung. Eine zweite Gruppe erhielt dagegen keine Förderung – ein Umstand, der unseren heutigen ethischen Standards widerspricht. Im Alter von 36 Monaten wurden die Kinder erneut untersucht. Die Kinder der Interventionsgruppe wiesen im Schnitt einen durchschnittlichen kognitiven Entwicklungsstand auf. Die Kinder der Kontrollgruppe fielen deutlich dahinter zurück und jene Kinder, die neben dem sozialen auch ein biologisches Risiko aufwiesen, befanden sich an der Grenze zur kognitiven Minderbegabung (  Abb. 2.2). Auch wenn viele Punkte der Studie hinterfragt werden können, insbesondere der frühe Zeitpunkt einer Intelligenzdiagnostik, die ethischen Probleme des Studiendesigns etc., zeigt das Beispiel deutlich, wie stark sich Risiken aufaddieren können. Gleichzeitig unterstreicht die Studie eindrucksvoll die Bedeutung früher Förderung von Kindern.
Abb. 2.2). Auch wenn viele Punkte der Studie hinterfragt werden können, insbesondere der frühe Zeitpunkt einer Intelligenzdiagnostik, die ethischen Probleme des Studiendesigns etc., zeigt das Beispiel deutlich, wie stark sich Risiken aufaddieren können. Gleichzeitig unterstreicht die Studie eindrucksvoll die Bedeutung früher Förderung von Kindern.

Abb. 2.2: Vorschulisches Training kognitiver Fertigkeiten bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien (Zeskind & Ramey, 1981). Die negativen Auswirkungen sozialer und biologischer Risiken addieren sich nicht nur (Kontrollgruppe), sondern sie können durch eine frühe intensive Förderung zumindest teilweise kompensiert werden.
2.4 Exkurs: Wie entstehen Normwerte?
Normwerte dienen der Einschätzung der relativen Stellung einer Person in Bezug auf eine Vergleichspopulation. Bezogen auf kognitive Fähigkeiten sind sie gleichzeitig ein Schätzer für die altersspezifische Ausprägung latenter Eigenschaften wie Intelligenz, Lesefähigkeit, Rechenfähigkeit etc. (A. Lenhard et al., 2019), die normalerweise eine Normalverteilung aufweisen. Wie kommt das zustande?



Ein Gedankenexperiment: Nehmen Sie eine Münze und werfen Sie diese zehnmal. Bilden Sie eine Summe und zählen Sie immer dann, wenn Sie Kopf erhalten, einen Punkt hinzu, bei Zahl ziehen Sie einen Punkt ab. Sie können die Wahrscheinlichkeit des spezifischen Ausgangs genau berechnen. Dies geschieht durch eine Bernoulli-Kette auf der Basis eines Binomialprozesses. Es ist dabei unwahrscheinlich, dass Sie einen extremen Wert erhalten, also beispielsweise immer nur Kopf oder immer nur Zahl werfen. Dementsprechend ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie plus oder minus zehn erhalten, doch je näher Sie sich der Null nähern, desto wahrscheinlicher wird das Ergebnis. Im konkreten Fall erhalten Sie in 25 % der Fälle eine 0. Erhöht man nun die Anzahl der Würfe auf 100 und führt das Experiment sehr häufig durch, dann nähert sich diese Kurve immer stärker einer Normalverteilung an. Wenn also viele Ereignisse unabhängig voneinander additiv zusammenwirken und ein solches Experiment sehr häufig durchgeführt wird, dann ergibt sich eine Normalverteilung.
Dieser Vorgang lässt sich nun auch auf komplexe menschliche Fähigkeiten anwenden. Immer dann, wenn unterschiedliche Faktoren sich aufsummieren und eine große Anzahl an Personen gegeben ist, dann wird die Verteilung einer Normalverteilung folgen. Wenn man diese Eigenschaft bei einer repräsentativen Stichprobe misst und das Messinstrument (z. B. ein standardisierter psychologischer Test) gut in allen Bereichen differenziert, dann wird sich auch hier eine Normalverteilung ergeben, die durch ihren Mittelwert und die sog. Standardabweichung (Wurzel des Durchschnitts des quadrierten Abstands der einzelnen Fälle vom Mittelwert) beschrieben werden kann. Kennt man diesen Mittelwert und die Standardabweichung, dann lassen sich in der Folge Normwerte, wie z. B. die IQ-Skala oder die T-Wert-Skala, berechnen und es lässt sich einschätzen, wie extrem ein Ergebnis ist. Um den Mittelwert, also +/− eine Standardabweichung, liegen mehr als 68 % der Personen (  Abb. 1.2) und man definiert diesen Bereich als den unauffälligen Normalbereich. Ein IQ zwischen 85 und 115 ist dementsprechend eine durchschnittliche Begabung. Je extremer der Abstand zum Mittelwert wird, desto weniger Fälle befinden sich in der Stichprobe. Oberhalb von +2 Standardabweichungen sind es noch 2,28 % und das Gleiche gilt auch für den Bereich ≤ −2 Standardabweichungen. Im ersten Fall spricht man von einer kognitiven Hochbegabung, im letzteren von einer kognitiven Minderbegabung.
Abb. 1.2) und man definiert diesen Bereich als den unauffälligen Normalbereich. Ein IQ zwischen 85 und 115 ist dementsprechend eine durchschnittliche Begabung. Je extremer der Abstand zum Mittelwert wird, desto weniger Fälle befinden sich in der Stichprobe. Oberhalb von +2 Standardabweichungen sind es noch 2,28 % und das Gleiche gilt auch für den Bereich ≤ −2 Standardabweichungen. Im ersten Fall spricht man von einer kognitiven Hochbegabung, im letzteren von einer kognitiven Minderbegabung.
Dies lässt sich nun nicht nur auf die Einschätzung eines individuellen Ergebnisses anwenden, sondern auch auf größere Gruppen. Bei einer Einwohnerzahl von 83 Millionen Menschen könnte man bei Normalverteilung des IQs davon ausgehen, dass sich in Deutschland 1,89 Millionen Menschen mit Hochbegabung und ebenso viele Menschen mit einer Minderbegabung befinden. Hochbegabungen und Minderbegabungen sind also zwar seltene Fälle, aber sie betreffen bei einer hinreichend großen Stichprobe dennoch sehr viele Menschen.
Читать дальше
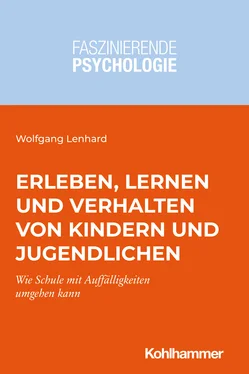
 Abb. 2.2).
Abb. 2.2).














