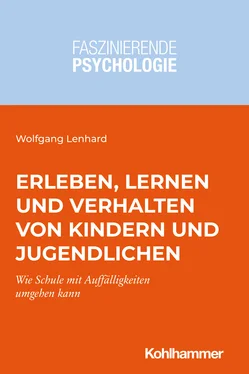Die enorme Variation der Anteile sonderpädagogischen Förderbedarfs nach Bundesland lässt sich auch dadurch erklären, dass je nach Verwaltungserlass unterschiedlich progressiv diagnostiziert wird. Zudem gibt es regionale Unterschiede hinsichtlich soziodemografischer Variablen, wie z. B. Arbeitslosigkeit oder Strukturwandel, die ihre Spuren in der Schülerschaft hinterlassen. Insgesamt sind die großen Unterschiede jedoch wenig plausibel, sodass die Einschätzung dessen, was als förderbedürftig eingestuft wird, nicht vollständig objektiv geklärt werden kann. Festhalten lässt sich jedoch, dass Lernprobleme mit weitem Abstand der häufigste Anlass für sonderpädagogische Maßnahmen darstellen.
Betrachtet man die Regelungen in den Diagnosemanualen, so tragen diese leider nur begrenzt zu einer Schärfung der Begrifflichkeiten bei: Zwar enthalten DSM-5 und ICD-11 Sektionen zu spezifischen Lernproblemen des Lesens, Schreibens und Rechnens, Spezifikationen zu unterschiedlichen Graden geistiger Behinderung, Sprachproblemen etc., aber nicht zu allgemein unterdurchschnittlicher Lernleistung, die im deutschen Schulsystem unter dem Begriff Lernbehinderung zusammengefasst wird. Eingrenzungen anhand von IQ-Bereichen, wie z. B. der Bereich zwischen IQ 60 und 85, erweisen sich als wenig zielführend, da ein solcher Anteil ca. 15 % der Bevölkerung umfasst. Der Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist jedoch deutlich kleiner, sodass es nicht ausreichen kann, lediglich den IQ zu messen. Daten eigener Untersuchungen (A. Lenhard & Lenhard, 2011) zeigen zudem, dass an Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen auch Kinder unterrichtet werden, die hinsichtlich des IQs (über-)durchschnittlich sind, dennoch aber massive Schulleistungsprobleme aufweisen, die beispielsweise aus Aufmerksamkeitsproblemen oder anderen Verhaltensstörungen resultieren. Während die Intelligenz als eine der bewährtesten Informationsquellen zur Vorhersage der generellen Leistungsentwicklung gilt, ist ihre Aussagekraft in spezifischen Personengruppen unter Umständen eingeschränkt, beispielsweise, da es sehr starke Ausfälle in einzelnen Intelligenzbereichen gibt.
Hasselhorn und Gold (2013, S. 177) versuchen, die Unsicherheiten in der Definition von Lernbehinderung mittels IQ-Definitionen zu reduzieren, indem neben einem IQ < 85 zusätzlich Probleme im Lesen, Schreiben und Rechnen auftreten müssen. Neben diesem Operationalisierungsversuch existieren jedoch noch zahlreiche andere Ansätze, wie beispielsweise von Vaughn und Fuchs (2003). Diese gehen vom schulischen Leistungsniveau aus und schlagen vor, jene Kinder als lernbehindert einzustufen, die a) ein niedriges Ausgangsniveau schulischer Leistungen aufweisen und b) über einen längeren Untersuchungszeitraum hinweg keine Fortschritte machen. Lernbehindert sind somit jene Personen, die nicht von Instruktion profitieren, also im eigentlichen Sinn im Lernen behindert sind, da sie keine Fortschritte machen. Diese Definition deckt sich mit älteren Definitionsversuchen aus dem pädagogischen Bereich: »Als lernbehindert gelten Kinder und Jugendliche, die ein chronisch und durchgehend erniedrigtes schulisches Lernniveau haben, bzw. permanent und relativ umfassend beeinträchtigte schulische Aneignungsprozesse aufweisen« (Kobi, 2004). Neuere Definitionen versuchen dagegen, gesellschaftliche Normvorstellungen und institutionelle Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: »Lernbehinderung wird vielmehr verstanden als eine derart ausgeprägte, verschärfte Situation negativer Abweichung im schulischen Lernen, dass die allgemeine Schule, so wie sie im deutschen Bildungssystem existiert, sie nach ihrem Verständnis und Auftrag mit ihren Mitteln und Möglichkeiten (einschließlich zusätzlich aufgewandter Förderung) nicht mehr auf ein erträgliches Ausmaß reduzieren kann und zu tolerieren bereit ist« (Schröder, 2005, S. 95). Im Gegensatz zu den bisherigen Erklärungen, wird in dieser Definition der Schwerpunkt auf die entsprechenden Schulen verlagert, welche mit ihren Mitteln in der Lage sein müssen, dem Förderbedarf nachzukommen. Sollten sie es nicht sein, so gilt das entsprechende Kind als lernbehindert. Weinert und Zielinski (1977) fokussieren auf die Belastungen, die mit der Überwindung von Lernbehinderungen einhergehen: »Lernschwierigkeiten liegen vor, […] wenn die Leistungen eines Schülers unterhalb der tolerierbaren Abweichung von verbindlichen institutionellen, sozialen und individuellen Bezugsnormen liegen [und] wenn das Erreichen (bzw. das Verfehlen) von Standards mit Belastungen verbunden ist, die zu unerwünschten Nebenwirkungen im Verhalten, Erleben oder in der Persönlichkeitsentwicklung des Lernenden führen«. Eine Lernbehinderung liegt also gemäß dieser Definition vor, wenn die Schule überfordert ist, das soziale Umfeld es nicht auffangen kann, und das Kind für sich selbst unterhalb der erwünschten Leistungen liegt. Außerdem ist der Lernprozess mit Belastungen verbunden, welche zu Nebenwirkungen im Leben oder in der Persönlichkeitsentwicklung führen. Basierend auf diesen Definitionsversuchen lässt sich also zusammenfassend festhalten, dass eine Lernbehinderung folgendermaßen gekennzeichnet ist:



Synthese der Definitionen zum Begriff »Lernbehinderung«
1. Es handelt sich um ein dauerhaftes Unterschreiten einer Leistungsnorm.
2. Diese Leistungsnorm ist von der Gesellschaft definiert.
3. Das Schulversagen ist abhängig von:
a. individuellen Faktoren
b. institutionellen Rahmenbedingungen
c. gesellschaftlichen und politischen Zielvorstellungen
4. Die Erreichung der Leistungsnorm wäre nur unter enormen Belastungen möglich
d. persönlich
e. institutionell
2.2 Das »Wait-to-fail«-Problem
Das Thema Lernstörungen spielt in allen Schulformen und allen Altersbereichen eine Rolle. Diese basieren einerseits auf individuellen Faktoren (  Kap. 4und
Kap. 4und  Kap. 5). Andererseits trägt aber auch die Organisation des Schulsystems in gewisser Weise dazu bei. In der Grundschule sind sie vielleicht am deutlichsten sichtbar, da diese Schülerschaft noch nicht stark selektiert ist und eine große Heterogenität aufweist. Je nach Organisation des Schulsystems (ein- versus dreigliedrig) reduziert sich diese Heterogenität ab der Sekundarstufe zum Teil, jedoch bleibt trotzdem eine große Leistungsvariabilität innerhalb der betreffenden Gruppen bestehen, selbst wenn man so stark ausgewählte Stichproben wie z. B. Hochbegabtenklassen betrachtet. Zudem ist die Regelschule immer auch durch inklusive Beschulung mit dem Themengebiet Lernstörungen konfrontiert. In einer großen epidemiologischen Untersuchung stellten Fischbach et al. (2013) beispielsweise fest, dass in Regelschulen 23,3 % der Schülerschaft von Lernproblemen im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen oder einer Kombination betroffen ist. Unter Einbezug von Kindern mit unterdurchschnittlicher Intelligenz steigt dieser Anteil auf 32,8 %. Selbst wenn man eine Diskrepanz zur Intelligenz und ein mindestens durchschnittliches Intelligenzniveau voraussetzt, so beträgt dieser Anteil immer noch 13,3 % der Kinder. In Regelschulen ist somit in einer Klasse von 25 Kindern oder Jugendlichen davon auszugehen, dass zwischen 3 und 8 Schülerinnen und Schüler massive Lernprobleme aufweisen.
Kap. 5). Andererseits trägt aber auch die Organisation des Schulsystems in gewisser Weise dazu bei. In der Grundschule sind sie vielleicht am deutlichsten sichtbar, da diese Schülerschaft noch nicht stark selektiert ist und eine große Heterogenität aufweist. Je nach Organisation des Schulsystems (ein- versus dreigliedrig) reduziert sich diese Heterogenität ab der Sekundarstufe zum Teil, jedoch bleibt trotzdem eine große Leistungsvariabilität innerhalb der betreffenden Gruppen bestehen, selbst wenn man so stark ausgewählte Stichproben wie z. B. Hochbegabtenklassen betrachtet. Zudem ist die Regelschule immer auch durch inklusive Beschulung mit dem Themengebiet Lernstörungen konfrontiert. In einer großen epidemiologischen Untersuchung stellten Fischbach et al. (2013) beispielsweise fest, dass in Regelschulen 23,3 % der Schülerschaft von Lernproblemen im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen oder einer Kombination betroffen ist. Unter Einbezug von Kindern mit unterdurchschnittlicher Intelligenz steigt dieser Anteil auf 32,8 %. Selbst wenn man eine Diskrepanz zur Intelligenz und ein mindestens durchschnittliches Intelligenzniveau voraussetzt, so beträgt dieser Anteil immer noch 13,3 % der Kinder. In Regelschulen ist somit in einer Klasse von 25 Kindern oder Jugendlichen davon auszugehen, dass zwischen 3 und 8 Schülerinnen und Schüler massive Lernprobleme aufweisen.
Читать дальше