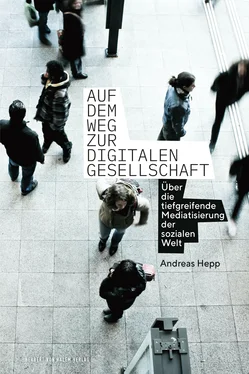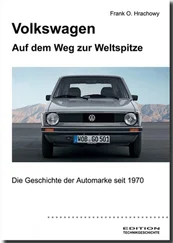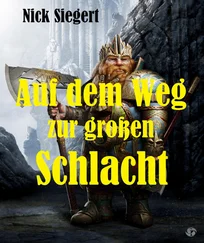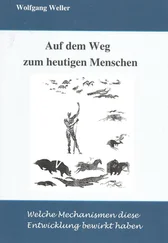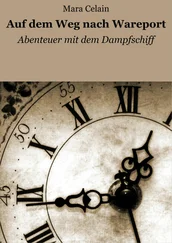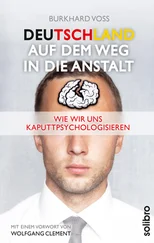Wenn wir bei unserer Analyse des Entstehens der digitalen Gesellschaft den Weg der materialistischen Phänomenologie beschreiten, können wir die tiefgreifende Mediatisierung als einen Prozess rekursiver Transformation verstehen (COULDRY/HEPP 2017: 216-218). ›Rekursivität‹ ist ein Begriff, dessen Ursprünge in der Logik und Informatik liegen. Er bedeutet, dass Regeln auf die Entität, die sie generiert hat, erneut angewandt werden (KELTY 2008). Dies ist ein generelles Moment des Sozialen: Wir erhalten eine soziale Entität wie beispielsweise eine Gruppe aufrecht und nehmen notwendige Anpassungen vor, indem wir entlang der Regeln und Normen, auf denen sie basiert, erneut handeln, wenn Probleme auftreten, gegebenenfalls mit einer gewissen Variation. 14Bei der tiefgreifenden Mediatisierung sind wir allerdings mit einer gesteigerten Rekursivität konfrontiert: Da viele heutige Praktiken digitale Medien einbeziehen, die auf Software und den damit verbundenen Algorithmen basieren und fortlaufend Daten generieren, potenziert sich Rekursivität: 15Selbst scheinbar einfache Handlungen, die von sozialen Akteur:innen ausgeführt werden, gestatten als Quelle von Daten das Erschließen möglicherweise versteckter, unsichtbarer oder gar nur unterstellter Regelhaftigkeiten, die dann die Basis weiterer Verarbeitungsschleifen und Datenrepräsentationen werden. 16Ein Beispiel dafür sind die verschiedenen Online-Stores, deren Plattformen fortlaufend automatisiert anhand des Kaufverhaltens von Kund:innen auf ›Regelhaftigkeiten‹ schließen, die dann u.a. als Kaufempfehlungen präsentiert werden, was wiederum mögliche Kaufentscheidungen anderer Kund:innen nach sich zieht, wodurch die computerisierten Annahmen der Regelhaftigkeit ggf. erst zur sozialen Regel werden. Die Transformation der Gesellschaft wird nicht nur zu einer tiefgreifend rekursiven, sondern bezieht in diesen Prozess auch Imaginationen mit ein: Imaginationen davon, wie sich etwas verändern sollte, werden als Regelsetzungen in Datenverarbeitungsalgorithmen eingeschrieben, die auf die sozialen Phänomene, über die sie Daten sammeln, angewendet werden und durch diese rekursiven Schleifen selbst ein einflussreicher Faktor bei der Transformation sozialer Phänomene sein können. Vermittelt durch digitale Medien und deren Infrastrukturen werden die Imaginationen der Regelhaftigkeit zur sozialen Regel selbst.
1.3DIE KAPITEL DIESES BUCHES
Es sind die bisher umrissenen Überlegungen, ausgehend von denen ich in diesem Buch eine Annäherung an die entstehende digitale Gesellschaft wagen möchte. Während dieses einleitende Kapitel eine erste Darstellung des Konzepts der tiefgreifenden Mediatisierung geleistet und es innerhalb der weiteren Mediatisierungsforschung verortet hat, zielen die folgenden Kapitel darauf ab, die soziale und technologische Formierung der tiefgreifenden Mediatisierung genauer herauszuarbeiten sowie empirisch zu erfassen.
Das Kapitel 2mit dem Titel Das Zustandekommen der tiefgreifenden Mediatisierung beginnt mit einer akteurszentrierten Perspektive auf diesen Prozess und diskutiert dessen Entwicklungsgeschichte. Dabei befasse ich mich sowohl mit korporativen Akteuren (Technologiekonzernen und Regierungen) als auch mit kollektiven Akteuren (den verschiedenen Pioniergemeinschaften, die die medientechnologische Entwicklung imaginiert und befördert haben). Mein Hauptanliegen ist es zu zeigen, dass das ›Zustandekommen‹ der tiefgreifenden Mediatisierung nicht allein auf die Aktivitäten großer Unternehmen und Regierungen reduziert werden kann, wie es oft im Ansatz der Politischen Ökonomie der Medien gemacht wird. Wir haben es vielmehr mit einem rekursiven Zusammenspiel von korporativen und kollektiven Akteuren zu tun und können die Entstehung der tiefgreifenden Mediatisierung nur begreifen, wenn wir diese Dynamik kennen. In ihrem gegenwärtigen Stadium führte diese Dynamik zu fünf quantitativen Trends des Wandels der Medienumgebung: die Ausdifferenzierung einer Vielzahl von medialen Endgeräten, deren zunehmende Konnektivität durch das Internet, die steigende Omnipräsenz dieser Medien durch mobile Kommunikationstechnologien, ein beschleunigtes Innovationstempo und schließlich das Aufkommen der Datafizierung.
In Kapitel 3 Medien als Prozess argumentiere ich, dass es unmöglich ist, die tiefgreifende Mediatisierung ohne einen angemessenen Medienbegriff zu erfassen. Mein Hauptanliegen in diesem Kapitel ist es, Medien als Prozess zu verstehen. Medien sind nicht einfach da, sondern sie entstehen in einem fortlaufenden Prozess der Institutionalisierung und Materialisierung von Kommunikation. Medien auf diese Weise zu betrachten, wirft ein neues Licht auf die Diskussion um die Medienlogik. Es wird deutlich, dass der prozessuale Charakter von Medien in dem Moment am greifbarsten wird, in dem sie digital werden: Basierend auf Algorithmen und digitalen Infrastrukturen werden sie in engen Rekursivitätsschleifen generiert und existieren als ›ständige Beta-Versionen‹ und damit in einer fortlaufenden Veränderung. Während Medien durch ihre Institutionalisierung und Materialisierung die soziale Welt prägen, würden wir uns einer gewissen Verdinglichung hingeben, wenn wir dabei von festen Logiken als inhärenten Eigenschaften von Medien ausgehen würden. Um das Entstehen der digitalen Gesellschaft durch die tiefgreifende Mediatisierung zu erfassen, muss man hingegen den Blick für die Prozesshaftigkeit digitaler Medien schärfen, zumal deren Fähigkeit, die soziale Welt zu formen, nie von einem einzigen Medium ausgeht. Wir haben es mit einer Mannigfaltigkeit der Medien in gesamtgesellschaftlichen Medienumgebungen zu tun, die sich in den Medienensembles verschiedener sozialer Domänen und in den Medienrepertoires der Individuen konkretisiert.
In Kapitel 4 Ein figurationsanalytischer Ansatz wird ein grundlegender Zugang zur entstehenden digitalen Gesellschaft dargestellt. Vereinfacht gesagt, sind Figurationen musterhafte Konstellationen von Menschen, wie sie in Familien, Gemeinschaften, Organisationen oder rund um bestimmte Medien zu finden sind. Mein Hauptargument in diesem Kapitel ist, dass wir, wenn wir die tiefgreifende Mediatisierung verstehen wollen, unsere Analyse nicht bei den Medien selbst beginnen lassen sollten, sondern bei einer vergleichenden Betrachtung der Figurationen verschiedener sozialer Domänen und deren Veränderung mit digitalen Medien und ihren Infrastrukturen. In Bezug auf die Gesellschaft ist das Hauptargument eines solchen Ansatzes, dass ihr Wandel am besten als ein Prozess rekursiver Transformation zu verstehen ist, den wir Refiguration nennen können: ein struktureller Wandel von Figurationen selbst wie auch ihrer Wechselbeziehung untereinander, wobei digitale Medien und Infrastrukturen die Schleifen der Rekursivität intensivieren. Ein solcher Zugang zum Entstehen der digitalen Gesellschaft hat enge Bezüge zu einer ›nicht-medienzentrierten Perspektive‹, die zuerst die menschlichen Praktiken analysiert und dann die Frage stellt, welche Rolle digitale Medien und Infrastrukturen bei der Veränderung dieser Praktiken haben.
Das Kapitel 5 Die Refiguration der Gesellschaft konzentriert sich auf den gesellschaftlichen Wandel hin zur digitalen Gesellschaft. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den sich verändernden Relationalitäten von Figurationen durch Mythen, Daten und Infrastrukturen, auf der Transformation bestehender Figurationen von Organisationen (am Beispiel der öffentlichen Debatte und der journalistischen Nachrichtenproduktion) und von Gemeinschaften (am Beispiel lokaler und transnationaler Familien) sowie auf der Entstehung neuer Figurationen (am Beispiel von Plattformkollektivitäten, konnektiver Praxis und globalen Finanzmärkten). Bei all diesen Beispielen geht es auch um das, was man als ›Akti vierung‹ des Medienensembles der einzelnen Figurationen bezeichnen kann, oder konkreter gesprochen darum, wie die Automatisierung von Kommunikation und das Aufkommen kommunikativer Roboter die soziale Konstruktion der Gesellschaft verändern. Insgesamt möchte ich mit diesem Kapitel zeigen, dass tiefgreifende Mediatisierung ein Transformationsprozess ist, der figurationsübergreifend erfolgt, gleichzeitig aber in Bezug auf einzelne Arten von menschlichen Figurationen Besonderheiten aufweist.
Читать дальше