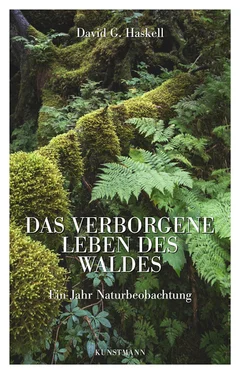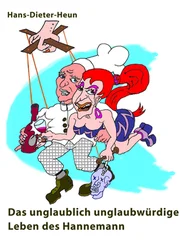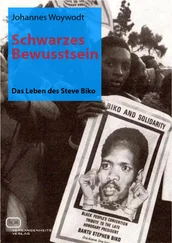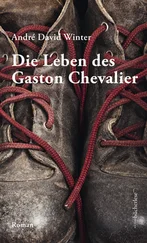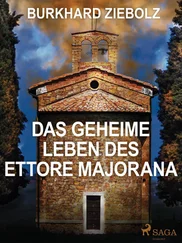Der Salamander vor mir ist doppelt so lang wie mein Daumennagel. Hals und Beine sind zierlich und zeichnen ihn als Mitglied der Gattung Waldsalamander ( Plethodon ) aus: Es könnte ein Zickzacksalamander oder ein Rotrückensalamander sein. Aber da Waldsalamander vielfältige Zeichnungen aufweisen und kaum erforscht sind, ist eine genaue Bestimmung schwierig. Zudem steht nicht einmal fest, was die »Gattung« Salamander wirklich ausmacht. Die Natur wird unserem Bedürfnis nach klarer Grenzziehung augenscheinlich nicht gerecht.
Der Salamander ist klein, vermutlich ein Jungtier, das letzten Sommer geschlüpft ist. Seine Eltern haben sich im vergangenen Frühling umworben – mit heikler Beinarbeit und zärtlichem Wangenreiben. Salamanderhaut gleicht einem Patchwork aus Duftdrüsen: Wenn Salamander ihre Wangen aneinanderreiben, flüstern sie chemische Liebesgedichte aus Pheromonen. Hat sich das Paar dann näher kennengelernt, hebt das Weibchen seinen Kopf, und das Männchen gleitet unter seine Brust. Er läuft vorwärts und sie folgt, wobei sich sein Schwanz in einem Congatanz für zwei bewegt. Nach ein paar Schritten legt er einen kleinen Gallertstift mit Samenpaket am Boden ab. Schwanzwedelnd läuft er weiter, und das Weibchen folgt. Dann hält sie inne und nimmt mit ihrer muskulösen Kloake den Samen auf. Der Tanz bricht ab, beide gehen ihres Weges und werden sich nie wiedersehen.
Das Weibchen sucht sich einen Felsspalt oder ein hohles Holzstück, wo es seine Eier ablegt. Dann umschlingt es die Eier mit seinem Körper und verhaart sechs Wochen im Nestloch, länger, als die meisten Singvögel brüten. Es wendet die Eier regelmäßig, damit die Embryonen nicht an den Innenseiten haften bleiben. Abgestorbene Eier werden aufgefressen, um eine Schimmelbildung zu verhindern, die das gesamte Gelege umbringen würde. Wenn andere Salamander im Nestloch vorbeischauen, um von den Eiern zu naschen, werden sie von der brütenden Mutter verjagt. Mutterloser Nachwuchs wird unweigerlich von Schimmel befallen oder von Räubern aufgefressen. Eine wachsame Mutter ist also lebenswichtig. Erst wenn die Jungen geschlüpft sind, enden ihre elterlichen Pflichten, und dann macht sie sich im Laubboden auf Futtersuche, um ihre erschöpften Energiereserven wieder aufzufüllen. Die jungen Salamander sind eine Miniaturausgabe ihrer Eltern. Sie stolzieren über den Waldboden und ernähren sich vollkommen selbstständig. Der Waldsalamander, der durchs Mandala huscht, benetzt in seinem Leben nicht mal eine Zehenspitze mit Wasser aus einem Bach, Tümpel oder Teich.
Der Brutvorgang räumt gleich mit zwei Mythen auf. Erstens, Amphibien seien zum Brüten auf Wasser angewiesen: Der Waldsalamander ist eine nicht amphibische Amphibie, auch wenn diese Klassifizierung im Grunde so schwierig zu halten ist wie der Salamander selbst. Und zweitens, Amphibien seien »primitiv« und kümmerten sich daher nicht um ihre Jungen. Der zweite Irrtum gründet auf Theorien zur Evolution des Gehirns, die »höhere« Funktionen wie Brutpflege nur »höheren« Tieren wie Säugetieren und Vögeln zugestehen. Die umsichtige Wachsamkeit der Mutter beweist, dass elterliche Fürsorge im Tierreich weiter verbreitet ist, als hierarchiegläubige Hirnforscher annehmen. In Wahrheit kümmern sich viele Amphibien um ihre Eier oder Jungen – ebenso wie Fische, Reptilien, Bienen, Käfer und eine ganze Menagerie aufopferungsvoller »primitiver« Eltern.
Der jugendliche Salamander im Mandala muss noch ein oder zwei Jahre im Laubboden auf Nahrungssuche gehen, ehe er geschlechtsreif ist. Plethodon ist, was die Nahrungsaufnahme betrifft, ganz der fleischlichen Lust verfallen. Salamander sind die Haie des Laubbodens: Sie durchstreifen die Gegend und verschlingen kleine wirbellose Tiere. Die Evolution hat beim Waldsalamander die Lungen ausgemustert – und sein Mäulchen dafür zu einer umso effektiveren Falle gemacht. Weil der Salamander keine Luftröhre hat und durch die Haut atmet, kann er seine Beute – völlig atemlos – niederringen. Er hat mit dem Shylock der Evolution einen Deal geschlossen: eine bessere Zunge gegen einige Gramm Lungengewebe. Der Waldsalamander nutzt seinen Dreitausend-Dukaten-Kredit weidlich, um die feuchten Laubböden der ostamerikanischen Waldgebiete zu erobern. Bislang ging die Wette auf, doch es könnte sein, dass der Wucherer seine Schulden eines Tages eintreibt. Sollten Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung die Bedingungen im Laubboden verändern, ist Plethodon schlecht gerüstet. Vorhersagen über die globale Erderwärmung und ihre Folgen gehen jedenfalls von einem starken Rückgang der Bergsala manderpopulationen aus, weil ihr feuchtes Habitat verschwindet.
Wie Waldsalamander zu ihrem lungenlosen Leben gekommen sind, weiß niemand genau. Ihre Verwandten besitzen Lungen, wenngleich die von Bergbachbewohnern nur relativ klein sind. Weil kühle Bäche sauerstoffreich sind, können die bächeliebenden Salamander ihre Haut als Atemorgan nutzen. Sind die terrestrischen lungenlosen Salamander vielleicht weiterentwickelte Abkömmlinge ihrer bachverliebten Verwandtschaft? So lautete jedenfalls die gängige Erklärung der Biologen, ehe sie einen näheren Blick auf die geologische Vergangenheit warfen. Das Gestein erzählte eine unbequeme Geschichte: Zur Zeit, als sich der Waldsalamander entwickelte, waren die ostamerikanischen Gebirge nur unbedeutende Hügel. Ihre sanften Abhänge konnten keine kühlen Bachschnellen hervorbringen, in denen kleinlungige Salamander gern verweilten. Wir besitzen also kein historisches Narrativ, das die fehlenden Lungen des Plethodon schlüssig erklären könnte.
Das Mandala ist beinah groß genug, dass die gesamte Welt des Salamanders darin Platz findet. Die erwachsenen Tiere besetzen ein Revier und streunen nur selten mehr als einige Meter weit. Manche Exemplare legen größere Strecken in Richtung Erdreich zurück als auf dem Laubboden. Die Bodenständigkeit der Waldsalamander hat eine enorme Vielfalt an Arten hervorgebracht. Weil sich die meisten Salamander kaum vom Fleck bewegen, kreuzen sie sich selten mit Exemplaren von der anderen Berg- oder Talseite. Die lokalen Populationen passen sich folglich an die besonderen Eigenschaften ihres Habitats an. Wenn sich Abweichungen lange genug fortsetzen, können Populationen neue äußere Erscheinungsbilder und genetische Merkmale entwickeln. Manche können sogar zu einer neuen »Art« werden, wenn der aktuelle Trend in der Taxonomie es so will. Die Appalachen sind ein alter Gebirgszug, der im Süden, wo das Mandala liegt, nie vom mörderischen Mantel der Eiszeitgletscher bedeckt war. Der Salamander hatte also reichlich Zeit, in einer Artenvielfalt zu gedeihen, die anderswo auf unserem Planeten ihresgleichen sucht. Genau diese Artenvielfalt macht es so schwierig, die Salamander zu klassifizieren.
Zum Pech für den Salamander wachsen in den feuchtwarmen Wäldern, die seine Artenvielfalt hervorgebracht hat, aber auch große, gewinnbringende Bäume. Und wenn die Bäume großflächig abgeholzt werden, verwandelt sich der schattige Laubboden in eine sonnenverbrannte Wüste, und alle Salamander sterben. Ist die abgeholzte Fläche zufälligerweise von altem Waldbestand umgeben und wird einige Jahrzehnte in Ruhe gelassen, kehren die Salamander nach und nach zurück. Die Populationen erreichen allerdings nicht mehr ihre ursprüngliche Größe, warum, weiß man nicht. Vielleicht wird durch die großflächige Rodung die genetische Feinabstimmung der lokalen Population vernichtet. Außerdem werden durch Rodungen Bäume gefällt, die sonst umgestürzt wären und feuchte Spalten, Nestlöcher und Zuflucht vor der Sonne geboten hätten. In der Fachsprache heißen die lebensspendenden umgestürzten Bäume »Totholz« – welch unzutreffende Bezeichnung für das wichtigste Lebenselixier der Waldökologie.
Der Salamander im Mandala wächst zwischen umgestürzten Baumstämmen auf, die kreuz und quer in dem geschützten Flecken unberührten Waldes liegen. Doch selbst wenn Rodungen hier unwahrscheinlich sind, lebt er nicht gefahrlos. Dem Salamander fehlt der Schwanz; vermutlich ist er ihm bei einer Begegnung mit Maus, Vogel oder amerikanischer Ringelnatter abhandengekommen. Wenn Salamander angegriffen werden, werfen sie den Schwanz ab, um den Fressfeind abzulenken: Der Schwanz bricht ab und verfällt in wilde Zuckungen, die den Angreifer irritieren, während der Salamander flieht. Blutgefäße und Muskeln am Schwanz sind so ausgebildet, dass sie abgeklemmt werden, wenn der Schwanz abfällt. Zudem ist die Schwanzhaut dünner und verengt, vermutlich, damit der übrige Körper beim Abwerfen des Schwanzes unverletzt bleibt. Die Evolution hat sich bei diesen Tieren also auf zwei Tauschgeschäfte eingelassen: Bessere Mäulchen wurden mit der Lunge bezahlt und ein längeres Leben mit einem abfallenden Schwanz. Der erste Tausch ist unumkehrbar, der zweite zeitlich begrenzt, denn der Schwanz wächst auf mysteriöse Weise nach.
Читать дальше