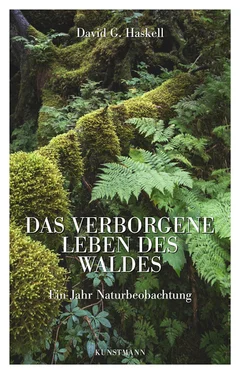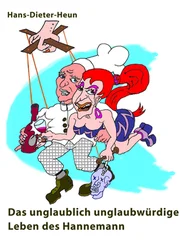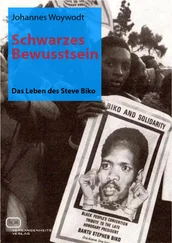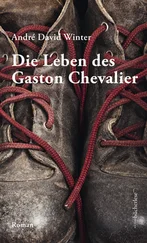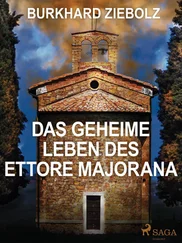Das Drängen und Drücken Tausender Zellen verlieh der Pflanze eine neue Fülle und erlöste das Moos aus seinem schlaffen Winterdasein. Große, runde Zellen an den Blattachseln pumpten sich voll Wasser und schoben die Blättchen von den Stämmchenachsen weg: Es entstand Stauraum für Wassertropfen, und die Blattoberflächen zeigten wieder himmelwärts. Auf den konkaven Blattinnenflächen haftet das Wasser. Die konvexen Blattaußenflächen verwandeln Licht und Luft in Moosnahrung. Der Regen ließ die Blättchen anschwellen und machte ein jedes zu Wassersammler und Sonnenfänger, zu Wurzel und Ast.
Im Zellinneren dagegen herrschte Verwüstung. Hereinströmendes Wasser wirbelte die Zelleingeweide durcheinander. Durchnässte Membranen lockerten sich so rasch, dass manches Zellinnenleben ausgeschwemmt wurde: Zucker und Mineralstoffe, für immer verloren. Flexibilität kostet. Doch das Drunter und Drüber währte nicht lange. Bevor die Moospflanze im Winter austrocknete, hatte sie vorsichtshalber chemische Reparaturstoffe in ihren Zellen gelagert. Sie sorgen jetzt dafür, dass die geflutete Zellmaschinerie wiederhergestellt und stabilisiert wird. Sobald die angeschwollene Zelle ihr Gleichgewicht dann zurückgewonnen hat, stockt sie den Vorrat an Reparaturstoffen wieder auf. Und sie saugt sich voller Zucker und Proteine, die ihr helfen, die Maschinerie bei Trockenheit erneut einzumotten.
Moospflanzen sind also jederzeit auf Dürre und Überflutung vorbereitet. Andere Pflanzen gehen die Katastrophenvorsorge entspannter an und stellen ihr Erste-Hilfe-Paket erst dann zusammen, wenn der Notfall eingetreten ist. Doch das braucht Zeit: Überraschende Trocken- oder Regenperioden bringen die Bummelanten um, nicht aber die Moose.
Doch Moose überstehen Trockenheit nicht nur durch sorgfältige Vorbereitung. Sie können sich auch gegen extreme Dürren zur Wehr setzen, die die Zellen anderer Pflanzen schrumpeln und sterben lassen. Moose überhäufen ihre Zellen dazu mit Zucker: Er kristallisiert zu Kandis, der ihr Zellinneres glasiert und konserviert. Verdörrtes Moos könnte sehr schmackhaft sein, hätten die kandierten Zellen nicht so einen faserigen Überzug und diese bittere Würze.
Nach fünfhundert Millionen Jahren Landleben sind die Moose erfahrene Choreografen, die Wasser und Chemie vollkommen beherrschen. Das saftige, dichte Moos auf den Mandalafelsen beweist, welche Vorteile es hat, wenn der Körper flexibel und die Physiologie flink ist. Bäume, Büsche und Krautpflanzen der Umgebung liegen noch in Winters Ketten, doch die Moose wachsen frank und frei. Die Bäume können sich das frühe Tauwetter nicht zunutze machen. Später, im Sommer, dreht sich der Spieß dann um: Dann beherrschen die Bäume dank ihrer Wurzeln und inneren Leitungssysteme das Mandala und beschatten die wurzellosen Moose. Doch momentan hat die Bäume ihre ungeschlachte Größe gelähmt.
Doch der spätwinterliche Eifer der Moose ist nicht nur für sie selbst von Nutzen. Auch das Leben unterhalb des Mandalas profitiert vom wasserliebenden Moos. Obwohl der Starkregen den Hang mit seiner kinetischen Energie durchwühlt, ist das aus dem Mandala strömende Wasser glasklar. Es zeigt nicht einen Anflug von dem Schlamm oder Schlick, die aus den Feldern und Städten der Umgebung sickern. Die Moospflanzen und die dicke Laubschicht saugen die Feuchtigkeit auf, verzögern die erodierende Kraft der Regentropfen und verwandeln den Artillerieangriff auf den Waldboden in eine Liebkosung. Wenn das Regenwasser bergab fließt, wird der Boden durch ein kunstvolles Gewebe aus Kraut, Buschwerk und Baumwurzeln am Platz gehalten. Hunderte Arten arbeiten an diesem Webstuhl zusammen, durchdringen sich mit Kette und Schuss und lassen einen robusten, faserreichen Stoff entstehen, der auch bei Regen nicht reißt. Junge Weizenfelder und Vorstadtgärten mit englischem Rasen haben dagegen nur wenige, locker verwobene Wurzeln, die den Boden nicht halten.
Der Beitrag der Moose erschöpft sich aber nicht darin, eine erste Verteidigungslinie gegen die Erosionskraft des Wassers zu bilden. Weil Moose keine Wurzeln besitzen, absorbieren sie Wasser und Nährstoffe aus der Luft. Ihre rauen Oberflächen sind optimale Staubfänger und erhaschen, sobald ein Lüftchen weht, eine gesunde Dosis Mineralstoffe. Wenn der Wind saure Autoabgase oder giftige Metalle aus Kraftwerken herüberträgt, empfangen die Moose den Müll mit offenen Armen und nehmen die Umweltverschmutzung wohlwollend auf. Die Moose im Mandala reinigen den Regen von Industrierückständen: Sie umklammern die Schwermetalle aus Auspuffrohren und halten den Rauch der Kohlekraftwerke fest.
Wenn der Regen weiterzieht, halten die vollgesogenen Moospflanzen das Wasser zurück und geben es nur nach und nach frei. Die Wälder hegen und pflegen die Natur: Sie bewahren die Flüsse vor plötzlich anschwellenden Schlammfluten und sorgen in Trockenzeiten dafür, dass das Wasser weiterhin strömt. Wenn das Wasser der feuchten Wälder verdunstet, entstehen regennasse Wolken, und wenn der Wald groß genug ist, erzeugt er sogar seinen eigenen Regen. Wir nehmen dieses Geschenk des Waldes gewöhnlich hin, ohne auch nur einen Gedanken an unsere Abhängigkeit davon zu verschwenden; nur ab und zu reißen uns wirtschaftliche Überlegungen aus dem Dämmerschlaf. So entschied sich New York dafür, lieber die Catskill Mountains zu schützen, als eine menschengemachte Trinkwasseraufbereitungsanlage zu finanzieren. Millionen moosiger Mandalas in den Catskills waren günstiger als die technische Lösung. Und in Costa Rica gibt es Wassereinzugsgebiete, in denen die Wassernutzer am Unterlauf die Waldbesitzer am Oberlauf für den Service bezahlen, den sie mit ihrem bewaldeten Land leisten. Der menschliche Wirtschaftskreislauf orientiert sich dabei an den Realitäten des Naturkreislaufs und senkt so den Anreiz, den Wald abzuholzen.
Im Mandala knattert und prasselt der Regen weiter. Von meinem Sitzplatz aus höre ich zwei brüllende Bäche. Sie liegen zu beiden Seiten des Mandalas, ungefähr hundert Meter entfernt. Die Regenmassen haben die rieselnden Bächlein in donnernde Strudel verwandelt. Nachdem ich eine Stunde oder mehr in regenfester Kleidung ausgeharrt habe, bedrückt mich langsam das endlose Getöse. Doch das Moos fühlt sich offensichtlich mehr zu Hause denn je. Nach fünfhundert Millionen Jahren Evolution ist es für regennasse Tage bestens gerüstet.

AUS DER DICHTEN LAUBSCHICHT am Boden blitzt ein Bein hervor. Ein Schwanzstummel folgt und verschwindet im feuchten Laub. Ich bezähme meinen Drang, die Blätter zur Seite zu schieben; ich warte und hoffe, dass der Salamander noch einmal auftaucht. Einige Minuten später stößt ein glänzendes Köpfchen hervor, dann sprintet der Salamander aus seinem Versteck. Er verschwindet in einem anderen Loch, erscheint erneut, verfällt ins Laufen, stolpert über einen Blattstiel und purzelt nicht gerade anmutig in eine Vertiefung. Verwirrt richtet er sich wieder auf, klettert aus der Senke und duckt sich schließlich, um unter ein totes Blatt zu gleiten. Kühler, dichter Nebel liegt in der Luft, ich kann nur wenige Meter weit sehen, doch der Salamander wirkt, als würde er von der Sonne angeleuchtet. Die dunkle, glatte Haut ist silbern gescheckt. Schmale rote Streifen verlaufen über den Rücken. Seine Haut ist unglaublich feucht: eine Wolke, zu belebter Materie kondensiert.
Salamander blühen wie Moos bei Feuchtigkeit auf, doch die Moosstrategie, zu verdörren und auf bessere Zeiten zu warten, ist ihnen verwehrt. Sie folgen wie Nomaden der kühlen, feuchten Luft und tauchen, je nach Feuchtigkeitsverhältnissen, aus der Erde auf oder verschwinden wieder darin. Im Winter fliehen sie die Kälte, kriechen unter Gestein und Geröll und leben als Höhlenbewohner in unter irdischer, bis zu sieben Meter tiefer Dunkelheit. Im Frühling und Herbst klettern sie an die Oberfläche und jagen im Laubboden nach Ameisen, Termiten und winzigen Fliegen. Sommerhitze und Trockenheit treiben sie wieder in den Untergrund; nur in feuchten Sommernächten, ohne Austrocknungsgefahr, graben sich die Salamander an die Oberfläche, um dort zu schlemmen.
Читать дальше