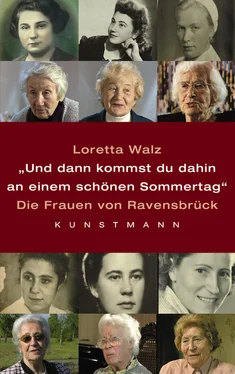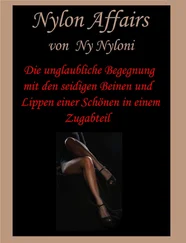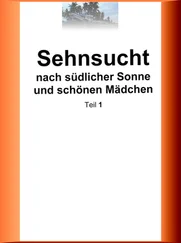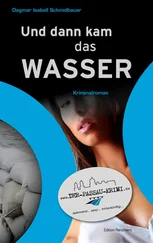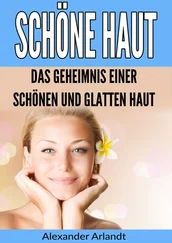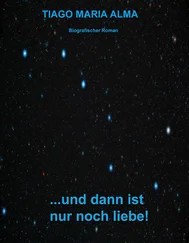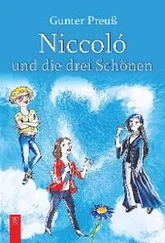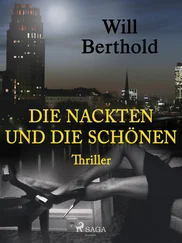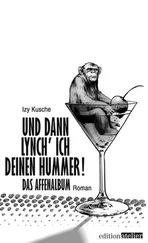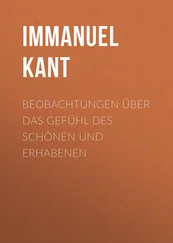1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Nach drei Tagen bekam Maria Zeh eine Arbeit beim Buchgroßhandel Koch, Neff & Oettinger, doch erst eine Woche später ihr erstes Gehalt. Bis dahin musste sie mit trockenem Brot und Wasser auskommen. Diese ersten Tage in der Freiheit waren für sie schwerer als die Zeit im Lager. » Das Zurückkommen war ganz furchtbar, weil ich aus dem Schoß einer warmen Familie komme. Wenn ich heute zurückdenke, wir waren sehr reich, kein Wohlstand, aber wir haben das nicht gespürt durch die Wärme meiner Mutter. Das ist so traurig gewesen, dass meine Mutter wegen mir starb. Wir hatten ein ganz inniges Verhältnis. Und dann bin ich weggekommen. Meine Mutter war doch eine bürgerliche Frau und ist aus Sehnsucht nach mir sehr, sehr erkrankt. Sie hat sich furchtbar geschämt, dass in unserer Familie so was vorkommt. Einmal ist die Gestapo mit mir zu ihr gefahren. Da lag sie im Bett und sagte, sie hätte immer gebetet, dass sie mich wiedersieht. Da hat der Gestapo gesagt, der Mistkerl, der sich selber nachher aufgehängt hat, der hat gesagt, ich darf dableiben, wenn ich sage, was sie wollen. Meine schwer kranke Mutter hat sich aufgesetzt und gesagt, einen Verräter hätte sie nicht erzogen! Das wollte sie nicht, dass ich Leute verrate. Man hat mir erzählt, dass sie im Krankenhaus immer nach der Türe geschaut hätte und hoffte, dass ich käme. Dann ist sie gestorben. Ich hab in meiner Zelle gesessen, und man hat mir gesagt, meine Mutter sei gestorben. Immer wenn ich Glockenschläge höre, dann fällt mir das ein .«
Als Maria Zeh von ihrer großen Einsamkeit erzählte und wie sie sich ohne Arbeit, ohne Geld ein neues Leben aufbauen musste, schien mir das vollkommen unverständlich. Warum konnte sie, die so vielen geholfen hatte und die deswegen viereinhalb Jahre eingesperrt war, nirgendwo Unterstützung finden?
Nicht ohne Enttäuschung und verbitterten Unterton erklärte sie mir, dass es für die früheren Genossinnen und Genossen gefährlich war, mit einer Kontakt aufzunehmen, die aus den Fängen der Gestapo kam. Stand sie im Verdacht, eine Verräterin geworden zu sein? Dachte man, sie würde diejenigen, die sie kannte, ausliefern? Die Genossen mussten doch wissen, dass sie niemanden verraten hatte, sonst wären sie doch selbst verhaftet worden. » Ach Kind «, sagte sie, » was weißt du über die Menschen? « Als ich weiterbohrte und fragte, wo denn ihr Mann gewesen sei, der wäre doch, wie sie, zwangsweise geschieden worden, fand sie mich vollkommen naiv: » Russland ist groß, und der Zar ist weit! « Viereinhalb Jahre seien eine zu lange Zeit. Ihr Mann habe eine neue Frau gefunden, zu ihr selbst blieb ein freundschaftlicher Kontakt.
Obwohl sie dies sehr bedauere, sei ihr vollkommen bewusst gewesen, dass sie niemals nahtlos an das Leben würde anknüpfen können, aus dem die Verhaftung sie gerissen habe.
Maria Zeh fand schließlich eine Wohnung im Stuttgarter Süden, in der sie noch wohnte, als wir uns kennen lernten. Anfangs habe sie zur Untermiete gewohnt und später die ganze Wohnung in dem schwäbischen Bürgerhaus übernommen. » Zum Beispiel haben sie mir ein Plakat an die Türe gemacht: ›Wer nicht mit »Heil Hitler« grüßt, ist ein Staatsfeind.‹ Gleichzeitig ist der Staub so hoch gewachsen, dass man hätte Kresse darauf säen können. Das waren die Leute unter mir. Es gab viele Schikanen. Aber wie das Leben so spielt: Letztes Jahr war niemand im Haus, die Frau war sterbenskrank, da hat sie mich gebraucht. Da hab ich nicht gesagt: ›Sie waren so und so‹, sondern da hab ich als Mensch gehandelt und habe sie versorgt. Ich bin so erzogen, für mich gibt es kein ›Auge um Auge, Zahn um Zahn‹, das ist eine angeborene und anerzogene Haltung, dass man Mensch bleibt. Ich bin nicht religiös, aber denk nur, gerade die Frau, die mir das Leben so schwer gemacht hat, hatte niemanden als mich, der für sie gesorgt hat .«
Die Zeit bis zum Kriegsende erlebte Maria Zeh in großer Einsamkeit: geschieden, die Mutter gestorben, kein Kontakt zu Genossen, und nur ein Bruder kehrte aus dem Krieg zurück. » Da hab ich das Leben erst kennen gelernt, in jeder Hinsicht. Ich durfte ja auch Stuttgart nicht verlassen, musste mich regelmäßig bei der Gestapo melden. Ich wollte nichts, außer wieder eine Existenz und mein eigenes Geld verdienen .«
»Sich rühren ist besser als gerührt sein«
Maria Zeh blieb allein, den Männern ihrer Generation misstraute sie. Zu viele Nationalsozialisten oder wankelmütige Sympathisanten waren unter ihnen. » Das hat etwas mit meinen Erfahrungen zu tun. Ich bin nicht kleinlich oder spießig, aber ich habe auch festgestellt, dass Frauen immer die Rechnungen bezahlen in einem Zusammenleben. Ich habe Frauen getroffen, die mit solchen Enttäuschungen lebten, doch der Mann kann immer ausziehen. Obwohl ich kein gesellschaftliches Ansehen wollte, habe ich gemerkt, dass man überhaupt kein gesellschaftliches Ansehen hat, wenn man älter ist und mit einem jüngeren Mann lebt. Ich bin auch keine Hausfrau mehr, die für einen Mann die Hemden wäscht, das wollte ich nicht mehr .«
Sie arbeitete ab 1945 in der Betreuungsstelle für die Opfer des Faschismus, engagierte sich in der Gewerkschaft ÖTV und gleich nach der Gründung in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – VVN. Die größte Erfüllung brachte ihr dann die Arbeit beim Stiftungsamt der Stadt Stuttgart, wo sie bis zur Pensionierung blieb. Ihr Engagement war unermüdlich, ihre Lebenssehnsucht und Lebensfreude außergewöhnlich. Einer solch aktiven Frau dieser Generation war ich nie zuvor begegnet.
Was sie ihr Leben lang nicht verlor, war die Angst vor der ›schwarzen Macht‹. Sie hatte eine große Angst vor den Faschisten und Neofaschisten. » Weil wir es gespürt haben! Glaubst du, dass man das vergisst? Ich weiß, dass die Reaktion immer zusammenhalten wird, dass wir für die stets Feinde sind .«
Als Beispiel führte sie an, dass die CDU-Regierung den politisch Verfolgten die Kuren abgelehnt habe. Alle seien krank aus dem Lager gekommen und auf staatliche Unterstützung angewiesen gewesen. Aus diesem Grund wollte Maria Zeh auch nie über Einzelheiten ihrer Widerstandsarbeit sprechen. Sie habe erlebt, dass antifaschistische Widerstandskämpfer, die im Verdacht standen, sich damals mit ›kriminellen‹ Mitteln zur Wehr gesetzt zu haben, nie eine Entschädigung erhalten haben. » Was mich mein Leben jetzt im Alter leben lässt, ist, dass ich – bei allen Androhungen von Verrecken und alledem – meine achtunddreißig Monate Einzelhaft durchgehalten habe, ohne jemanden belastet, verraten oder jemandem geschadet zu haben. Das hilft mir zu leben. Du kannst auch ›Stolz‹ dazu sagen. Ich werde niemals jemanden verurteilen, der sich die Pulsadern geöffnet, sich aufgehängt oder andere verraten hat. Es war eine solche Tortur, die kann man nicht beschreiben. Deshalb darf man über diese Menschen nicht urteilen. Aber dass ich die Kraft hatte, das durchzustehen, das hilft mir heute leben. Es ist ja nicht leicht, alleine zu leben im Alter, aber es ist noch schwerer, wie ich die Frauen erlebt habe, die ein paarmal verlassen wurden von einem Mann – das könnte ich nicht ertragen. Schlimm ist, dass die besten Freunde, die zehn, fünfzehn Jahre jünger sind, dass die sterben. Wie ich zum Beispiel leide über den Tod von Doris Maase und anderen, mit denen man die Enge erlebt und vieles auf Leben und Tod gewagt hat. Wenn die dann wegsterben, das ist schlimm. Es hat ja keiner gedacht, dass man so alt wird. Ich hab jetzt noch ein Leben voller Sehnsucht. Zum Beispiel hab ich mir Möbel angeschafft, da sagen die Leute: ›Ach, in deinem Alter!‹ Ich bin nicht für Luther, aber das sag ich wie Luther: ›Wenn ich wüsste, ich müsste morgen sterben, dann pflanze ich trotzdem noch ein Apfelbäumchen.‹ Das heißt, das Leben geht weiter. Ich will das. Ich leb auch noch sehr gerne. Mit allen Gebrechen und mit allem, was nicht angenehm ist. Aber ich reiß mich auch schwer zusammen. Für die Zeiten, in denen ich mich einsam fühle, hab ich mir einen Spruch von Bert Brecht angewöhnt: ›Sich rühren ist besser als gerührt sein.‹ Dann mach ich irgendwas. Ich hab immer irgendwo etwas, was man machen muss .«
Читать дальше