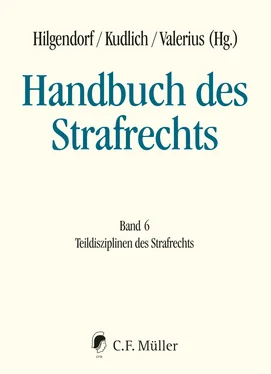53
Einige Neuerungen für die Arbeit der Ethikkommissionenwird die Implementierung der VO (EU) Nr. 536/2014 über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln mit sich bringen. Nach der in Art. 2 Abs. 2 Nr. 11 der Verordnung aufgenommenen Definition handelt es sich bei einer Ethikkommission um ein in einem Mitgliedstaat eingerichtetes unabhängiges Gremium, das gemäß dem Recht dieses Mitgliedstaats eingesetzt wurde und dem die Befugnis übertragen wurde, Stellungnahmen für die Zwecke dieser Verordnung unter Berücksichtigung der Standpunkte von Laien, insbesondere Patienten oder Patientenorganisationen, abzugeben. Da nicht alle nach Landesrecht gebildeten Ethikkommissionen in Deutschland einen Patientenvertreter in ihren Reihen hatten, war es erforderlich, deren Zusammensetzung durch nationales Recht neu zu regeln.[185] Seit Ende 2016 müssen sich die Ethikkommissionen gemäß § 41a AMG registrieren;[186] Vorgaben für ihre Zusammensetzung enthält § 41a Abs. 3 Nr. 2 AMG. Gemäß § 41 AMG n.F. muss die Stellungnahme der Ethikkommission, die von der zuständigen Bundesoberbehörde gemäß § 41 Abs. 3 S. 1 AMG n.F. maßgeblich zu berücksichtigen ist, ein klares Votum zur Vertretbarkeit der Durchführung der klinischen Prüfung sowie eine entsprechende Begründung enthalten.[187] Aufgrund der verkürzten Fristen und des Prinzips der stillschweigenden Genehmigung, wird die Gefahr einer negativen Beeinflussung der Qualität der Entscheidungen gesehen.[188] Vorschriften zur Beteiligung der Ethikkommission enthält schließlich auch das Strahlenschutzgesetz (vgl. §§ 31 Abs. 4 Nr. 6, 36 StrlSchG).[189]
F. Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Risiken der medizinischen Forschung
54
Auf dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen sollen nunmehr die straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Risiken der medizinischen Forschungin den Blick genommen werden. Dabei bietet sich eine Differenzierung an, die am Forschungsobjekt und an der gewählten Forschungsmethode anknüpft. Im Vordergrund sollen die Vorschriften des Kern- und Nebenstrafrechts stehen, die von den weniger eingriffsintensiven Tatbeständen des Ordnungswidrigkeitenrechts lediglich flankiert werden.
I. Arzneimittelforschung mit Erwachsenen
55
Den Ausgangspunkt der Betrachtung bildet die Arzneimittelforschung mit Erwachsenen, die gewissermaßen den Grundfall des medizinischen Forschungseingriffes bildet und die größte praktische Bedeutung besitzt.[190] Der bislang dem AMG zugrunde liegenden Systematik folgend, ist dabei zwischen gesunden und kranken Probanden sowie zwischen einwilligungsfähigen und einwilligungsunfähigen Probanden zu unterscheiden.
1. Gesunde, einwilligungsfähige Personen
56
Wie beim individuellen Heilversuch (dazu Rn. 31 ff.) entfaltet auch beim Forschungseingriff vor allem die unangemessen riskante und die nicht konsentierte Behandlung strafrechtliche Relevanz. Anknüpfungspunkte für einen strafrechtlichen Vorwurf können sich danach zum einen aus einem unvertretbaren Verhältnis zwischen eingriffsspezifischen Risiken und zu erwartendem Nutzenund zum anderen aus Aufklärungs- und Einwilligungsmängelnergeben, welche die Wirksamkeit der Zustimmung des Probanden beeinträchtigen. Darüber hinaus vermögen auch Verstöße gegen prozedurale Sicherungsmechanismen wie z.B. Genehmigungserfordernisse oder Qualifikationsanforderungen eine Strafbarkeit des Prüfers zu begründen. Wie bereits dargelegt (vgl. Rn. 41 ff.), haben die bei der Durchführung klinischer Prüfungen zu beachtenden formellen und materiellen Anforderungen in den (noch) geltenden §§ 40, 41 AMG eine spezialgesetzliche Regelung erfahren. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist auch bei der strafrechtlichen Bewertung von Forschungseingriffen zu berücksichtigen, die im Rahmen einer klinischen Prüfung vorgenommen werden.[191] Dabei ist zwischen den nebenstrafrechtlichen Tatbeständen in § 96 Nr. 10 und 11 AMG und den Vorschriften des Kernstrafrechts zu unterscheiden, die neben denen des AMG anwendbar bleiben.[192] In Betracht kommt eine Strafbarkeit wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperverletzung (§§ 223 ff., 229 StGB[193]), bei tödlichem Ausgang auch eine solche nach den Tötungsdelikten (§§ 211 ff., 222 StGB). Hinzu tritt zukünftig die Strafvorschrift des § 96 Nr. 21 AMG n.F., die Verstöße gegen bestimmte, enumerativ aufgezählte Vorgaben der VO (EU) Nr. 536/2014 mit Strafe bedroht.
57
Im Kernstrafrecht werden der Forschung mit gesunden einwilligungsfähigen Probanden zunächst durch das in § 216 StGBnormierte Verbot der Tötung auf Verlangen Grenzen gezogen. Das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Probanden, ihn zu töten, zieht danach nicht die Straflosigkeit des Prüfers, sondern lediglich eine Privilegierung der Tötung gegenüber den §§ 211 ff. StGB nach sich.[194] Während es sich hierbei eher um einen theoretischen Fall handeln dürfte, kommt der Vorschrift des § 228 StGB, nach der die mit Einwilligung der verletzten Person vorgenommene Körperverletzung rechtswidrig ist, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt, durchaus praktische Bedeutung zu. Die Rechtsprechung stellt in diesem Zusammenhang in Übereinstimmung mit der hL grundsätzlich auf die Intensität des tatbestandlichen Rechtsgutsangriffes ab; dabei sollen in erster Linie der Umfang der vom Opfer hingenommenen körperlichen Misshandlung oder Gesundheitsschädigung und der Grad der damit verbundenen Leibes- oder Lebensgefahr maßgeblich sein.[195] Die Grenze zur Sittenwidrigkeit sei danach jedenfalls dann überschritten, wenn bei vorausschauender objektiver Betrachtung aller maßgeblichen Umstände der Tat der Einwilligende durch die Körperverletzungshandlung in konkrete Todesgefahr gebracht werde.[196] Nur ausnahmsweise soll eine Kompensation des auf dieser Grundlage getroffenen Sittenwidrigkeitsurteils durch einen positiven Handlungszweck in Betracht kommen; dies wird insbesondere bei lebensgefährlichen ärztlichen Eingriffen angenommen, die zum Zwecke der Lebenserhaltung vorgenommen werden. Medizinisch indizierte Eingriffe verstoßen daher nicht gegen die guten Sitten.[197] Die vorstehend skizzierten Maßstäbe sind grundsätzlich auch bei der Bewertung medizinischer Forschungseingriffe zu berücksichtigen;[198] allerdings erfährt das Sittenwidrigkeitsurteil nach § 228 StGB bei der klinischen Prüfung eine eigenständige Konkretisierung durch die in § 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 AMG (bzw. zukünftig Art. 28 Abs. 1 lit. a der VO (EU) Nr. 536/2014) getroffene spezialgesetzliche Regelung der Risiko-Nutzen-Abwägung: Sind bei einem Forschungseingriff nach dem insofern maßgeblichen objektiven ex ante-Urteil[199] „die vorhersehbaren Risiken und Nachteile (der klinischen Prüfung) gegenüber dem Nutzen für die Person, bei der sie durchgeführt werden soll (…), und der voraussichtlichen Bedeutung des Arzneimittels für die Heilkunde ärztlich vertretbar“,[200] so scheidet eine Bewertung des Eingriffes als sittenwidrig i.S.d. § 228 StGB aus.[201] Umgekehrt erscheint bei einem negativen Ergebnis der nach § 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 AMG bzw. Art. 28 Abs. 1 lit. a der VO (EU) Nr. 536/2014 vorzunehmenden Güterabwägung auch die Annahme der Sittenwidrigkeit gemäß § 228 StGB vorgezeichnet.[202]
58
Die vorstehend skizzierte Akzessorietät ist auch ansonsten für das Verhältnis der kernstrafrechtlichen Delikte gegen Leib und Leben zu den Vorschriften des AMG und der VO (EU) Nr. 536/2014kennzeichnend: So führt etwa die Einhaltung der in §§ 40, 41 AMG bzw. §§ 40a, 40b AMG n.F. und Art. 28 ff. der VO (EU) Nr. 536/2014 normierten probandenschützenden Vorgaben im Bereich der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit[203] dazu, dass die Durchführung der Studie grundsätzlich als Eingehung eines erlaubten Risikos zu bewerten ist,[204] während bei einem Verstoß gegen die vorbezeichneten Vorschriften auch die Schwelle der rechtlich missbilligten Gefahr überschritten wird. Für die Strafbarkeit des Prüfers ist dann allerdings noch genauer zu erörtern, ob auch die übrigen Zurechnungsvoraussetzungen (insbesondere der Pflichtwidrigkeits- und der Schutzzweckzusammenhang[205]) gegeben sind.[206] Schließlich erfahren die allgemeinen Grundsätze, nach denen sich die Wirksamkeit der Einwilligung in Körperverletzungen gemäß §§ 223 ff. StGB bestimmt,[207] für den Bereich der klinischen Prüfung eine Konkretisierung durch die in § 40 Abs. 1 S. 3 Nr. 3, Abs. 2 AMG (bzw. zukünftig in § 40b AMG n.F. und Art. 29 der VO (EU) Nr. 536/2014) normierten Anforderungen an die Aufklärung und die Einwilligung des Probanden.[208]
Читать дальше