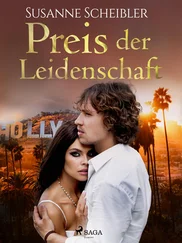»Halt’s Maul!« schrie er der Weinenden zu. »Sonst stopfe ich es dir und deinem Balg!«
Isabell zitterte am ganzen Leib. Sie wollte sich umwenden und davonlaufen, den Weg zurück, den sie gekommen war. In ihrer Hast achtete sie nicht darauf, wohin sie trat. Ihr rechter Fuß verfing sich im Gestrüpp, sie stolperte und stürzte. Unwillkürlich schrie sie auf, als Dornen und Zweige ihr die Haut zerkratzten.
Im nächsten Augenblick hörte sie hastige Schritte hinter sich. Eine grobe Faust packte sie und riß sie hoch.
Aus schreckgeweiteten Augen starrte Isabell auf den Mann, der sie festhielt. Er war blond und noch jung, aber sein Gesicht verriet Brutalität und Verschlagenheit. »Sieh an«, sagte er mit einem unangenehmen Lachen, »da habe ich ja einen hübschen Fang gemacht!«
Isabell wehrte sich heftig gegen den rohen Griff des Banditen, aber gegen seine Kraft kam sie nicht an. Er hielt sie an sich gepreßt und pfiff seinen drei Kumpanen, die gleich darauf zwischen den Büschen auftauchten.
»Hol’s der Teufel, ein Mädchen!« schrie einer von ihnen. Er hatte ein rotes, blatternarbiges Gesicht. »Und was für eines!« Mit einem breiten Grinsen zog er vor Isabell den Hut und erwies ihr eine übertriebene Reverenz. »Mademoiselle, ich bin entzückt. Wenn alles an Euch so reizend ist wie Euer Gesicht, hab’ ich heute meinen Glückstag.«
Die anderen lachten gröhlend, als der Bandit nach ihr griff. Ein kurzer Ruck, und Isabells Kleid war bis zur Taille aufgerissen. Der Blonde hielt ihr die Arme fest. Isabell stand völlig wehrlos da, den Blicken der Männer preisgegeben, und sie wußte, sie würden über sie herfallen wie wilde Tiere.
Verworrene Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Werden sie mich töten – nachher, wenn alles vorbei ist? Oder Werde ich es selbst tun, weil der Ekel mich erstickt? Kann man das jemals vergessen? Kann man je wieder die Hände eines Mannes auf seiner Haut ertragen, ohne zu schreien vor Entsetzen? Oder wird man stumpf, ausgehöhlt, empfindungslos ...
Sie schrie nicht, als man sie zu Boden warf. Sie wehrte sich nur mit zusammengebissenen Zähnen, mit der Geschmeidigkeit einer Wildkatze. Und sie dachte immer wieder: Ich kann es nicht ertragen, ich kann es nicht...
Sie sah das feiste Gesicht des Blatternarbigen über sich. Sie hörte, wie der Blonde protestierte: »Laß sie! Ich habe sie entdeckt. Sie gehört mir ...«
Und der andere antwortete mit einem rohen Auflachen: »Warte es nur ab, Söhnchen, du wirst sie schon noch bekommen.«
In diesem Augenblick umkrampften Isabells Finger den Griff eines Messers, das der Bandit im Gürtel trug. Es hatte sich bei dem Kampf gelockert und rutschte sofort aus der Scheide. Isabell handelte ganz mechanisch, ohne zu denken, wie ein in die Enge getriebenes Tier, das im Angriff den einzigen Ausweg sieht. Sie stieß einfach zu, stieß in diesen feisten, schweren Körper, der sie mit seinem Gewicht niederdrückte.
Der Blatternarbige brüllte auf. Er wälzte sich zur Seite und preßte die Hände gegen den Leib. Ehe die anderen recht begriffen, was geschehen war, war Isabell auf den Füßen und rannte davon, tiefer in den Wald hinein. »Das Luder!« schrie der Blatternarbige. »Bringt sie um. Sie hat mir das Messer in die Seite gerannt!«
Der Blonde riß als erster seine Reiterpistole hoch. Isabell hörte den dröhnenden Hall des Schusses. Ihr war, als glitte ein glühendes Eisen in ihren linken Oberarm. Im Laufen preßte sie die Hand dagegen und spürte, wie es heiß und klebrig zwischen ihren Fingern hervorsickerte.
In diesem Augenblick war von der Straße her Pferdegetrappel zu vernehmen. Es mußten mehrere Reiter sein, die da kamen, vielleicht sechs oder acht. Eine Kutsche folgte ihnen. Isabell hörte das Knirschen der Räder auf dem sandigen Boden.
»Verdammt!« schrie einer der Banditen. »Wir müssen verschwinden! Hier – durch das Unterholz; da holen sie uns mit den besten Pferden nicht ein.«
Hastig machten sich die drei davon, noch ehe die kleine Reiterkavalkade auf der Straße zum Halten kam. Ihren verletzten Kumpan ließen sie zurück.
Kriechend versuchte er, das schützende Gebüsch zu erreichen. »Wartet doch«, schrie er, »nehmt mich mit...« Aber niemand hörte auf ihn.
Der Graf Henry de Montfort war der Anführer der Eskorte, die an diesem Morgen den Wagen Liselottes von der Pfalz, der jetzigen Herzogin von Orleans, begleitete. Montfort war ein schlanker, achtundzwanzigjähriger Mann mit einem klaren, kühnen Gesicht, zu dem die träumerischen dunklen Augen einen reizvollen Gegensatz bildeten. Da er der kleinen Kavalkade vorausritt, sah er als erster den umgestürzten Planwagen auf der Straße. Die schwarzhaarige Frau kauerte noch immer im Staub bei ihrem Mann, das weinende Kind an sich gedrückt. Es war, als habe das Entsetzen sie blind und taub gemacht für alles, was um sie her geschah.
Montfort zügelte seinen Fuchs und rüttelte die Frau an der Schulter. »Was ist geschehen? Ein Überfall?« Er sprach französisch, und die Frau blickte ihn zunächst aus großen, verständnislosen Augen an. Dann schien sie den Sinn seiner Frage zu begreifen. Sie deutete zum Wald hinüber.
»Dort...« stammelte sie, »Banditen! Sie haben meinen Mann niedergestochen.«
Inzwischen waren die übrigen Reiter mit der Kutsche herangekommen. Die Männer sprangen von den Pferden. Drei von ihnen versuchten sogleich, den Planwagen aufzurichten, während sich die anderen zu Fuß an die Verfolgung der Wegelagerer machten.
Liselotte von der Pfalz hatte die lindgrünen Damastvorhänge an den Kutschfenstern beiseite gezogen und beugte sich hinaus. Henry de Montfort ritt zu ihr hin.
»Es wird hoffentlich nicht lange dauern, bis wir weiterkönnen. Bleibt solange im Wagen, Madame.«
Liselotte war viel zu tatkräftig und warmherzig, um seiner Aufforderung Folge zu leisten. Sie stieg aus und lief zu der Unglücksstelle hinüber. Der Verletzte war nicht bei Bewußtsein. Seine Frau versuchte, ihn auf die Seite zu drehen, in die ihn das Messer getroffen hatte. Das schreiende Kind – es war ein kleiner Junge von vielleicht drei Jahren – hing ihr am Rock.
Kurz entschlossen nahm Liselotte den Kleinen auf den Arm. »Aber Bübele«, sagte sie in ihrem Pfälzer Dialekt, den sie in den zehn Jahren ihres Aufenthaltes in Frankreich nicht verlernt hatte, »wer wird denn als weinen! Du bist doch kein Wickelditz mehr.«
Der Kleine starrte die fremde Dame in dem blauen Samtmantel mit offenem Mund an. Liselotte wischte ihm mit dem Taschentuch das tränenverschmierte Gesichtchen ab. »So, und jetzt bist du fein still. Es ist ja alles wieder gut.«
Seit jeher hatte Liselotte auf Kinder eine besondere Anziehungskraft ausgeübt. Das erwies sich auch jetzt. Die Tränen des Kleinen versiegten, und als Liselotte ihn hin und her wiegte, stahl sich sogar ein zaghaftes Lächeln auf das runde Kindergesicht.
Sie winkte Graf Montfort herbei. »Seid so gut und kümmert Euch um den Verletzten. Glaubt Ihr, daß man ihn mit seinem Wagen ins nächste Dorf bringen kann?«
»Ich denke schon. Er muß auf jeden Fall zu einem Arzt.«
»Holt Decken und Kissen aus der Kutsche, damit er eine bequeme Lagerstatt bekommt und das Rütteln des Wagens nicht so spürt.«
Liselotte wandte sich an die Frau, die begonnen hatte, breite Leinenstreifen von ihrem Unterrock abzureißen, um damit ihren Mann zu verbinden. »Wie heißt Sie, meine Liebe?«
»Katharina ... Katharina Helfrich, Ihro Gnaden. Wir gehören zum fahrenden Volk und wollten nach Straßburg. Der König ist dort, und bei solchen Anlässen gibt es immer einen Jahrmarkt, wo unsereins ein paar Heller verdienen kann. Aber nun ...« Ihre Stimme schwankte.
»Bis Straßburg kann Sie keinesfalls mit Ihrem Mann fahren. Am besten nimmt Sie sich im nächsten Gasthof ein Zimmer.« Liselotte holte ihre bestickte Geldbörse hervor und drückte sie der Frau in die Hand. »Hier – das wird Ihr eine Zeitlang weiterhelfen.«
Читать дальше