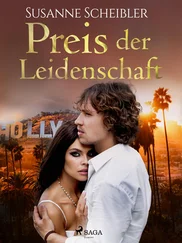»Ja«, sagte Liselotte, »ja, gewiß.« Sie versuchte, sich in die Lage ihrer Mutter zu versetzen. Wenn Philipp sich eines Tages von ihr, Liselotte, trennte? Wenn man sie um das Glück betrog, ihre beiden Kinder heranwachsen zu sehen ... Ein schrecklicher Gedanke!
»Ihr habt recht, Coppenstein«, sagte sie nachdenklich. »Ich werde sehr liebevoll zu ihr sein müssen.« Aber in ihr Lächeln mischte sich Beklommenheit. Liselotte wußte, daß guter Wille allein nicht genügte, um den Weg zum Herzen eines anderen Menschen zu finden – nicht einmal, wenn der andere die eigene Mutter war. Und sie hatte plötzlich ein wenig Angst vor dieser Begegnung nach über zwanzig Jahren.
Das trübe Grau der frühen Morgendämmerung lugte durch das schmale Fenster, als sich Isabell von ihrem Bett erhob. Sie hatte kaum geschlafen in dieser Nacht, der letzten, die sie in ihrem Elternhaus verbrachte. Sie hatte wach gelegen und auf den Wind gelauscht, der draußen im Apfelbaum rauschte und ab und zu einen Zweig mit klatschendem Geräusch gegen ihr Kammerfenster geschlagen hatte, auf das Bellen eines Hundes und das Rasseln eiliger Wagenräder über das Kopfsteinpflaster der Straße.
Es war nicht schön, in der Dunkelheit zu liegen und keinen Schlaf finden zu können. Aller Kummer, alle Ängste wurden riesengroß – Alpträumen gleich, die sich auf die Brust legten und das Atmen schwer machten.
Isabell war froh, daß jetzt der Morgen heraufdämmerte. Ha stig kleidete sie sich an, flocht das schwere, goldbraune Haar, das ihr bis zur Taille reichte, zu einem dicken Zopf und steckte ihn am Hinterkopf auf. Dann warf sie ein Tuch um die Schultern.
Die Straße mit den hohen, schmalen Häusern war menschenleer, als Isabell aus der Haustür trat. Am Himmel verblaßten die Sterne. Eine streunende Katze verschwand in der Toreinfahrt.
Isabell fröstelte im Morgenwind. Sie zog das Tuch enger um sich, nahm ihr Bündel und lief eilig die Straße entlang. Sie blickte sich nicht mehr um, denn sie wußte, daß sie dann den Abschied nicht ertragen hätte.
Aus dem Schatten eines Hauseingangs löste sich eine Gestalt. Es war Hans Breidach. »Isabell...«
Das Mädchen blieb stehen. »Aber Hans! Hast du auf mich gewartet? Wir haben doch schon gestern Abschied voneinander genommen.«
Er schluckte. »Ich mußte dich noch einmal sehen, Isabell. Bitte geh nicht fort!«
»Ich muß doch«, sagte sie leise. »Was soll ich noch hier? Seit mir Gertrude vor zwei Wochen den Dienst aufgesagt hat, war ich ganz allein im Haus. Ich bin Gertrude nicht böse darum. Sie hat es so lange bei mir ausgehalten, wie es ging. Aber in diesen Zeiten können zwei Frauen allein kein Gasthaus führen. Und ob ich einen Knecht gefunden hätte, der bereit gewesen wäre, uns vor betrunkenen Soldaten, vor Plünderung und Gewalttat zu schützen ...« Sie verstummte und senkte den Kopf. »Es gibt keine Silberne Rose mehr, Hans. Sie haben den Weinkeller ausgeräumt, alle Truhen und Schränke leergeplündert, die Matratzen und Polster aufgeschlitzt, ob Geld darin versteckt sei, und – als sie keines mehr fanden – in ihrer Wut selbst die Möbel zerschlagen. Aber warum erzähle ich dir das? Du weißt es doch ...«
Freilich wußte er es. Und für einen flüchtigen Moment überkam ihn Groll auf Isabells Vater. Hätte er nicht um ihretwillen schweigen müssen an jenem Tag, als man ihnen den Treueid abgepreßt hatte? Die Bittschrift, die man eilends verfaßt hatte, war zu spät gekommen; zu diesem Zeitpunkt lebte Meinhard Raven schon nicht mehr. Die Soldaten des Königs machten mit Aufrührern kurzen Prozeß.
Hans Breidach schaute Isabell an. Sie war so schön mit ihrem blassen, traurigen Gesicht... Er konnte sie nicht gehen lassen!
»Und wenn es dir nun nicht gefällt bei deiner Tante in Kehl?« fragte er drängend. »Wenn sie unfreundlich zu dir ist?«
»Der Brief, den sie mir geschrieben hat, war sehr freundlich. Und wo soll ich sonst hin? Ich habe keinen Menschen außer ihr.«
»Doch ...« Hans Breidach griff nach ihrer Hand. »Mich, Isabell! Ich hab’ dich lieb. Ich habe selbst nicht gewußt, wie sehr – bis gestern, als du kamst, um uns Lebewohl zu sagen. Es war bis jetzt immer so selbstverständlich, daß du da warst. Sag, willst du mich heiraten?«
Sie schaute ihn einen Augenblick schweigend an. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, Hans ...«
Sie sah, wie weh sie ihm getan hatte mit ihrer Antwort, aber sie hatte ihm keine andere geben können.
Isabell war siebzehn Jahre alt, sie wußte nicht viel von der Liebe. Da waren nur manchmal Träume gewesen von einem Mann, der eines Tages kommen und dessen Lächeln genügen würde, sie atemlos zu machen. Ein Mann, dessen Berührung sie zittern lassen und allen eigenen Willen auslöschen würde bis auf den einen: ihm anzugehören.
Der blonde Junge, der da vor ihr stand, war nicht dieser Mann.
Isabell griff nach ihrem Bündel, das die wenigen Habseligkeiten enthielt, die sie in ihr neues Leben mitnehmen wollte. »Adieu, Hans. Glaub mir, es ist besser, wenn ich gehe, auch wenn es dich jetzt traurig macht. Eines Tages wirst du über deinen Kummer lächeln.«
»Nie«, erwiderte er erstickt. Er blickte ihr nach, wie sie davonging, und zum erstenmal seit seiner Kindheit war ihm nach Weinen zumute.
Der Himmel im Osten färbte sich mit dem blassen Rot der aufgehenden Sonne, als hinter Isabell die Türme von Straßburg zurückblieben. Sie wanderte die staubige Straße entlang und spähte nach einem Bauernkarren aus, der sie vielleicht ein Stück Weges mitnehmen würde.
Sie hatte wohl noch ein wenig Geld, das sie vor den plündernden Soldaten hatte verstecken können. Es war genug, um mit der Postkutsche nach Kehl zu reisen. Aber Isabell Wußte nicht, was sie bei ihrer Tante erwartete. Deshalb wollte sie die paar Taler für den Notfall zurückbehalten. Sie kannte die älteste Schwester ihres Vaters kaum. Da war nur noch eine verschwommene Erinnerung, daß die inzwischen verwitwete Frau Babette Schollmeyer vor Jahren einmal in Straßburg zu Besuch gewesen war.
Isabell hatte der Tante den Tod von Vater und Bruder in einem Brief mitgeteilt, und Frau Babette hatte umgehend geantwortet.
›Es macht mir große Sorge, daß Du nun ganz allein lebst. Willst Du nicht lieber zu mir kommen?‹
Dann hatte sie noch hinzugefügt, daß sie ›gar greulich an der Gicht leide‹ und deshalb eine junge Hilfe gut gebrauchen könne.
Isabell seufzte. Sie war ja gern bereit, die Tante zu pflegen und zu versorgen. Hoffentlich war sie nur keine nörglige, launenhafte Kranke, der man nichts recht machen konnte.
Inzwischen war die Sonne vollends aufgegangen und vertrieb den Morgennebel, der in den Niederungen lastete. Die Straße führte jetzt durch einen Wald. Es ging ein wenig bergauf, und Isabell verlangsamte ihren Schritt. Plötzlich, an einer Wegbiegung, hörte sie Stimmen vor sich. Die jammernde einer Frau und das Weinen eines Kindes. Jemand lachte; es klang roh und mißtönend. Dann schrie ein Mann auf wie in höchster Todesnot. Ein Pferd wieherte schrill.
Isabell spürte ihr Herz hart gegen die Rippen klopfen. Sie wich in den Schatten der Bäume zurück. Ängstlich bemüht, kein Geräusch zu machen, schlich sie näher.
Hans Breidach und seine Eltern hatten sie gewarnt. Es sei gefährlich, in solchen Zeiten allein unterwegs zu sein. Überall wimmele es von Marodeuren und allerlei Gesindel. Aber Isabell hatte ihre Bedenken zerstreut. ›Bei Tage bin ich sicher. Da sind immer Leute unterwegs.‹
Sie erreichte die Stelle, wo die Straße einen Knick machte. Aus schreckgeweiteten Augen starrte Isabell auf das Bild, das sich ihr bot. Mitten auf dem Weg lag ein umgestürzter Planwagen. Drei verwegen aussehende Männer mit schweren Reiterpistolen im Gürtel und breitrandigen Federhüten auf dem Kopf waren damit beschäftigt, ihn auszuplündern. Johlend schleppten sie Kisten und Kästen ins Freie, rissen das Stroh der Lagerstatt auseinander, um nach ein paar Bettelpfennigen oder verstecktem Silberzeug zu suchen. Ein Mann lag stöhnend am Boden. Aus seinem Mund sikkerte ein dünner Blutfaden. Eine junge, schwarzhaarige Frau kniete neben ihm, ihr weinendes Kind an sich gepreßt. Das armselige Pferd, das den Wagen gezogen hatte, war bereits ausgespannt und wurde von einem vierten Wegelagerer weggeführt.
Читать дальше