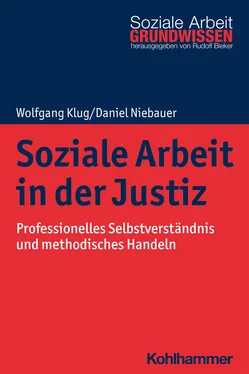1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 


Zusammenfassung: Was können wir also aus dieser Basistheorie für die Soziale Arbeit in der Justiz ableiten?
a. Probleme wie Kriminalität oder Abhängigkeitserkrankungen entstehen in einem Zusammenspiel aus Umwelt und Person, demzufolge sind Ansatzpunkte aus Sicht Sozialer Arbeit sowohl in der Veränderung der Person als auch in der Umwelt zu suchen, insbesondere in der Interaktion beider.
b. Zur Bewältigung von Problemen sind Ressourcen in der Person und der Umwelt nötig, besonderes Augenmerk ist also auf das Management der personalen und externen Ressourcen zu legen.
c. Soziale Arbeit spielt sich immer auf mehreren Ebenen ab, sie ist sowohl auf der Mikro-Ebene (Person) als auch auf der Meso-Ebene (Nahumwelt) sowie auf der Makroebene (politische Systeme) aktiv.
d. Zentral zum ökosozialen Sozialarbeitsverständnis gehört die »Advocacy«, d. h. die Einflussnahme zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Klient*innen.
2.2.2 Lebensweltliche Ansätze
Anders als der ökosoziale Ansatz, der sich in den letzten Jahren relativ wenig verändert hat (was durchaus kein Vorteil ist), ist der Lebensweltansatz komplexer Natur und durch die Vielzahl der von ihrem wichtigsten Autor Hans Thiersch vorgelegten Abhandlungen und Interpretationen vielschichtig und facettenreich. Es sollen deshalb nur einige wesentlichen, und für unseren Zusammenhang zentrale Gesichtspunkte herausgegriffen werden.
In einem programmatischen Artikel beschreiben Thiersch, Grunwald & Köngeter (2012) die Traditionslinien des Lebensweltansatzes, wonach die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit wie folgt charakterisiert ist. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit
a. steht in der hermeneutisch-pragmatischen Traditionslinie der Erziehungswissenschaft und
b. wurde zur sozialwissenschaftlichen und kritischen Pädagogik weiterentwickelt.
c. Dabei wurde die Frage nach dem Alltag und der je individuell interpretierten Welt der Menschen von immer zentralerer Bedeutung.
Wenn wir also die Hermeneutik als eines der drei wesentlichen Elemente dieser Theorie betrachten, begeben wir uns zunächst in die erziehungswissenschaftliche – genauer (sozial-) pädagogische – Entwicklungslinie.
Grundverständnis: Hermeneutik
Die Hermeneutik (griechisch »hermeneun« meint auslegen) ist der Versuch, durch systematische Verständigungsprozesse subjektive Sinnzusammenhänge beim anderen Subjekt zu begreifen und so zu einem gemeinsamen Such- und Findungsprozess zu kommen. Bezogen auf die Alltagswirklichkeit der Menschen (sprich der Klient*innen) will Hermeneutik Folgendes: »Sie rekonstruiert dieses Alltags- und Praxiswissen, um daran anschließend – mit Dilthey gesprochen – Methoden des ›höheren Verstehens‹ zu entwickeln. Praxis- und Theoriewissen werden jedoch nicht als grundsätzlich voneinander getrennt betrachtet, sondern höheres Verstehen wird durch die Entlastung vom alltäglichen Handlungsdruck ermöglicht. Dadurch wird eine kritische Distanz zu der aufzuklärenden Alltagspraxis hergestellt, ohne die Perspektive des Alltags und das Handeln im Alltag abzuwerten. Im Zentrum der hermeneutisch-pragmatischen Tradition steht also die immer bereits vorgefundene und vorinterpretierte, jedoch zugleich veränderbare Lebenswirklichkeit in ihrer historischen, kulturellen und sozialen Dimension« (Thiersch, Grunwald & Köngeter 2012, 182).
Hans Thiersch versteht seinen Lebensweltansatz nun in der Weise, dass er die traditionelle Hermeneutik »im Kontext der kritischen Alltagstheorie reformuliert und auf heutige sozialpädagogische Fragestellungen bezieht« (Thiersch 2002, 168, zit. in Erath & Balkow 2016, 189). Mit seiner (gesellschafts-)kritischen Alltagstheorie bezieht sich Thiersch auf die »Kritische Sozialpädagogik«, die in der Tradition von Klaus Mollenhauer steht.
Bezogen auf die Alltags- und Lebenswirklichkeit der heutigen Menschen stellt Thiersch fest, dass Lebensbewältigung angesichts der herrschenden Verhältnisse in der Selbstbehauptungsgesellschaft für immer mehr Menschen zum Problem wird. Zwar suggeriert der Sozialstaat, er würde umfassend versorgen, ohne dass die*der Einzelne Leistung, Disziplin, Zuständigkeit für die eigenen Verhältnisse einbringt, hinter dieser Fassade verbergen sich aber klare wettbewerbliche Prämissen, wie z. B. die Ideologien: »Leistung muss sich lohnen« oder »Unwille zur Leistung darf nicht hingenommen werden«, woraus dann im Letzten klar hervorgeht: Wenn Disziplin und Ordnung fehlen, greift auch der Wohlfahrtsstaat zu Ermahnungen und Strafen (Thiersch 2002, 21). Der für die soziale Marktwirtschaft prekäre Kompromiss zwischen Leistungsgerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit »verliert sich« (ebd.), die Gesellschaft spaltet sich in diejenigen, die dazu gehören und diejenigen, die nicht mithalten können. Im Kampf um knappe Ressourcen werden die Verlierer nicht nur in Ghettos abgedrängt, sondern auch noch als ›Schmarotzer‹ gelabelt. Thiersch schreibt quasi als seine ›Zeitdiagnose‹:
»Die Erosion traditioneller Lebensstrukturen und -muster im Kontext von Pluralisierung und Individualisierung bedeutet, aus traditioneller Enge in neue Offenheiten, in neue Optionen geworfen zu sein; bedeutet, sich im Rahmen der gegebenen Lebensstrukturen – und gerade auch der durch Ungleichheit eingeschränkten Lebensstrukturen – als Regisseur/in der eigenen Verhältnisse zu erfahren« (Thiersch 2002, 23).
Insofern bedeutet Verstehen der Lebensbedingungen heutiger ›Verlierer‹ der Leistungsgesellschaft das Betrachten
• von gesellschaftlichen Brüchen und Verwerfungen,
• des Verlustes traditioneller sozialer Systeme der Hilfe durch Kirchen und Assoziationen,
• der Notwendigkeit, Gerechtigkeit als soziale Gerechtigkeit zu realisieren, besonders zum Vorteil der am wenigsten begünstigten Mitglieder,
• des Kampfes um soziale Gerechtigkeit verstanden als Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen (vgl. ebd., 33).
Verstehen der lebensweltlichen Situation bedeutet damit auch Respekt vor den Erfahrungen und Bewältigungsleistungen gerade derer, die auf ausgleichende Gerechtigkeit angewiesen sind, statt diese Menschen zu disziplinieren. Selbst da, wo das Verhalten der*des Einzelnen für sie*ihn selber, für das Umfeld, ja für die ganze Gesellschaft unerträglich wird, muss der Respekt vor der Bewältigungsanstrengung vorherrschen.
Damit ist bereits das dritte beherrschende Thema des Lebensweltansatzes von Thiersch angesprochen: der Fokus auf den Alltag. Diesen erleben Menschen als durchaus widersprüchlich:
»Alltag ist bestimmt durch die entlastende Funktion von Routinen, die Handeln, Sicherheit und Produktivität erst ermöglichen, gleichzeitig aber auch in Form von Enge, Unbeweglichkeit und Borniertheit menschliches Leben einschränken und behindern. Alltag ist geprägt durch Differenzen und Widersprüche zwischen den Routinen des gelebten Lebens und dem Potential eines nicht gelebten Daseins mit seinen Möglichkeiten« (ebd., 132).
Auf der einen Seite gibt es also schwierige Verhältnisse, andererseits sind im Alltag Möglichkeiten und Potenziale verborgen, die nur geweckt – oder wie Grunwald und Thiersch an anderer Stelle sagen – »transzendiert« werden müssen (Grunwald & Thiersch 2018, 910). Es bedarf »detektivischer Kunst«, die Wahrheitsmomente im Alltag, Momente gelingenderen Lebens zu entdecken, bewusst und wach zu halten, zu stützen und zu mehren, ohne in traditionelle Muster der Fürsorglichkeit oder der Dominanz zu fallen (ebd.).
Читать дальше