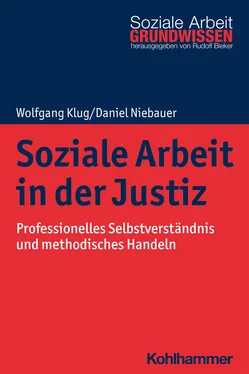Einen gewissen Gegenentwurf zur linearen »Anwendung« wissenschaftlichen Wissens stellt die Konzeption der Sozialen Arbeit – stark in Anlehnung an eine sozialpädagogische Denktradition – als Reflexionswissenschaft dar. Diese zielt letztlich darauf ab, der Praxis ein Bild ihrer selbst zu spiegeln, »so dass deren Nachdenken über sich selbst angereichert werden kann« (Sommerfeld 2011, 43). Dabei wird das Vermittlungsproblem von wissenschaftlichem Wissen in die Praxis aber nicht tatsächlich gelöst, sondern vielmehr das Auflösen der Dominanz der Wissenschaft gegenüber der Praxis in der »Ideologie der Reflexion verschleiert« (ebd. 44). Die hochkomplexe Vermittlung zwischen Wissenschaft und Praxis wird nun dem*der einzelnen unter Handlungsdruck stehenden Professionellen übertragen. Für die professionell handelnde Person besteht die Aufgabe nun darin, die Integration von wissenschaftlichem Wissen in die eigenen Praxisbezüge im Rahmen der »stellvertretenden Deutung« (Haupert & Kraimer 1991) zu bewältigen. Die Herausforderung der Relationierung – also wie tatsächlich wissenschaftliches Wissen systematisch in die Handlungspraxis einfließen kann – bleibt jedoch weiterhin bestehen (Sommerfeld 1998; 2011).
In diesem Spannungsfeld führt nun Sommerfeld, basierend auf einem handlungswissenschaftlichen Verständnis, das Modell der Kooperation als wesentlichen Vermittlungsmodus von Wissenschaft und Praxis an (vgl. Sommerfeld 1998; 2003; 2014). Hierbei sollen zum einen die Systemgrenzen von Wissenschaft und Praxis nicht nur aufrechterhalten, sondern auch verstärkt sichtbar gemacht werden. Zum anderen geht es aber darum, die Systemreferenzen durch Austausch- und Kooperationsprozesse höherer Ordnung neu zu gestalten (vgl. Sommerfeld 1998). Wie genau der Austausch und die Kooperation von Wissenschaft und Praxis im Rahmen des Modells von Sommerfeld aussehen, wird in Kapitel 8.2 ausführlicher beschrieben ( 
Kap. 8.2
).



Zusammenfassung: Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft
a. legt ihren Fokus auf das professionelle Handeln und darin auftretende Handlungsprobleme im Kontext der Praxis Sozialer Arbeit,
b. um in Kooperation (im Sinne des Modells von Sommerfeld) mit der Praxis gemeinsam bestmögliche Lösungen – also Konzepte, Methoden, Verfahren – zur Vermeidung, Beseitigung oder Milderung von psychosozialen Problemen zu entwickeln,
c. wenngleich bei diesen Kooperations- und Entwicklungsprozessen die Systemgrenzen und unterschiedlichen Systemlogiken von Wissenschaft und Praxis stets bestehen bleiben.
Literatur zum Weiterlesen



Grunwald, K. & Thiersch, H. (Hg.) (2016): Praxishandbuch Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Handlungszusammenhänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfeldern (3., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
Klug, W. (2003a): Mit Konzept planen – effektiv helfen. Ökosoziales Case Management in der Gefährdetenhilfe. Freiburg i. B.: Lambertus.
Klug, W. (2014): Bewährungshilfe auf dem Weg zur Fachsozialarbeit? Programmatik einer zukunftsfähigen Profession. In: Bewährungshilfe, 61 (4), 396–409.
Klug, W. (2016): Neoliberale Justizsozialarbeit? Wider die Deprofessionalisierung durch Vereinfachungen. In: Müller, C., Mührel, E. & Birgmeier, B. (Hg.): Soziale Arbeit in der Ökonomisierungsfalle? Wiesbaden: Springer VS, 173–193.
3 Auftrag und Zielsetzungen der Sozialen Arbeit im Handlungsfeld Justiz



In diesem Kapitel stehen der Auftrag und die grundlegenden Zielsetzungen der Sozialen Arbeit in den Sozialen Diensten der Justiz im Mittelpunkt. Hierfür wird das »doppelte Mandat« als unvermeidbar und geradezu konstitutiv für das Verständnis von Sozialer Arbeit in der Justiz beschrieben, aus dem sich sowohl ein Hilfeauftrag als auch ein Kontrollauftrag ableiten lassen. Dieses Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle ist insbesondere in Zwangskontexten von zentraler Bedeutung. Neben dieser eher auf den Einzelfall bezogenen Auftragsbestimmung gehört es für die Soziale Arbeit immer zu ihrer Zielsetzung, auch Verhältnisse zu verändern. Aus diesem Grund wird die Auftragsbestimmung zum Abschluss des Kapitels um eine sozialräumliche Perspektive erweitert.
3.1 Vorbemerkung
Anekdote zum Einstieg
In einem wissenschaftlichen Symposion entbrannte heftiger Streit, ob Instrumente der Risikoeinschätzung in der Bewährungshilfe entwickelt werden sollten oder nicht. Es wurden alle möglichen Argumente hin und her gewendet. Am Ende zeigte sich, dass die Auseinandersetzung um die Methodenwahl ihre Hauptursache darin hat, dass weder eine Klarheit über den Auftrag und die Zielsetzung noch über das Menschenbild bestand. Es war fast befreiend zu erleben, dass alle Teilnehmenden ›recht‹ hatten, weil sie getreu ihrer (nicht diskutierten) Grundverständnisse von Sozialer Arbeit in der Justiz bestimmte methodische Konsequenzen gezogen haben.
Beginnen wir mit einer Feststellung zur Auftragsklärung in der Sozialen Arbeit:
»Im Prozess der Auftragsklärung geht es darum, sozial die unterschiedlichen Erwartungen und Zielvorstellungen von anwesenden und nicht anwesenden Personen und Organisationen einzubeziehen und zu prüfen, welche Brücken sich zwischen unterschiedlichen Interessen bauen lassen« (Hosemann & Geiling 2013, 152).
Was Hosemann und Geiling über die Grundlage des Beratungsprozesses schreiben, gilt in gleicher Weise auf der konzeptionellen Ebene. Auf die Notwendigkeit von vorliegenden Konzepten als Strukturbedingung für die professionelle Fachlichkeit wurde an anderer Stelle ausführlicher hingewiesen (Klug 2003a). So ist es vor der Entwicklung methodischen Vorgehens unverzichtbar, Auftrag und Ziele klar zu beschreiben. Dies gilt in ganz besonderer Weise für die in der Justiz vorherrschenden Zwangskontexte. Eine Auseinandersetzung der Fachkräfte mit den Bedingungen ihres Arbeitsplatzes, Klarheit über die Ziele des eigenen Arbeitgebers und die damit verbundenen Rahmenbedingungen sind nicht nur unverzichtbar in der Methodenentwicklung, sie sind – dies kann nicht oft genug betont werden – das ›A und O’ der reflexiven Auseinandersetzung mit den Klient*innen in der Justizsozialarbeit (vgl. dazu sehr ausführlich und instruktiv Zobrist & Kähler 2017, 53ff.). Es ist nun mal ein gravierender Unterschied, ob eine Doppelrolle im Sinne von Hilfe und Kontrolle vorliegt (wie beispielsweise in der Bewährungshilfe), oder ob es diese nicht gibt (wie in der Freien Straffälligenhilfe). Im ersten Fall sind Motivationsmethoden ganz oben auf der Skala des zu entwickelnden Methodensets, im zweiten Fall sind Motivationsmethoden sicher nicht verkehrt, aber auch nicht alles entscheidend. Wenn man also nicht in einen methodischen Nihilismus (»Es hilft eh nichts!«) oder in einen entsprechenden Relativismus verfallen will (»Es ist jedem überlassen, was er machen will.«), ist vor der Konzept- und Methodenentwicklung ein genauer Blick auf die Rahmenbedingungen nötig.
Читать дальше