Bewährungshilfe wird also als spezialpräventive Maßnahme verstanden. An anderer Stelle wird noch einmal deutlich auf die Kontroll- und Überwachungsfunktion abgehoben:
»Erst diese Überwachung ermöglicht es dem Gericht zu beurteilen, ob der Verurteilte die in ihn gesetzte, die Strafaussetzung rechtfertigende Erwartung erfüllt, dass er künftig keine Straftaten mehr begehen wird. Der Bewährungshilfe kommt damit bei der Durchführung der Maßnahme eine Doppelrolle zu: Sie ist einerseits Hilfe für den Verurteilten und übernimmt die Aufgabe der sozialarbeiterischen Betreuung, und sie ist andererseits Hilfe für das Gericht und überstützt das Gericht bei der Überwachung und Kontrolle« (Meier 2019, 129).
Best bezeichnet die Justizsozialarbeiter*innen als »Helfer des Gerichts« und betont, dass durch die Bestellung durch das Gericht die Bewährungshilfe im weiteren Sinne abgeleitete Staatsgewalt sei (Best 1984, 67). An anderer Stelle wurde schon auf die gemeinsamen europäischen Bewährungshilfegrundsätze hingewiesen, aus denen ebenfalls als das eindeutige Ziel der Straffälligenhilfe die Verhinderung von Rückfällen und damit der Opferschutz hervorgeht (Morgenstern 2012). Dieses gilt in ähnlicher Weise auch für andere Bereiche der Straffälligenhilfe in staatlicher Hand.
Wenn demnach im Bereich der Kontrollfunktion der Auftrag der Rückfallprävention feststeht, stellt sich die Frage, wie dieser durchzuführen ist. Relativ einfach wird einleuchten, dass dieser Auftrag mit Hilfeangeboten alleine nicht zu erreichen sein wird, denn dagegen spricht schon der Zwangskontext, den der Gesetzgeber als nicht verhandelbare Rahmenbedingung der Justizsozialarbeit aufgegeben hat. Aus diesem Konstrukt geht hervor, dass der Auftraggeber selbst davon überzeugt ist, dass das Hilfeangebot auch abgelehnt werden kann und dass für diejenigen, die es ablehnen, noch andere Maßnahmen erfolgen sollten. Wie wir im Laufe unserer Betrachtungen noch sehen werden, sind aber einige Personengruppen (z. B. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen oder Abhängigkeitserkrankungen) häufig zu Beginn einer spezialpräventiven Maßnahme nicht in der Lage, das begangene Unrecht als von ihnen zu verantwortendes einzuordnen. Sie brauchen dazu unterstützende Maßnahmen in Form von deliktorientierten Analysen und Motivationsarbeit.
Ein weiteres Argument spricht gegen eine reine Angebotsorientierung im Sinne eines ›einfachen‹ Hilfemandats: Es ist keineswegs so, dass mit einer äußerlich stabilisierten Lebenslage (z. B. Arbeit und Wohnung) automatisch das Rückfallrisiko sinkt. Dagegen spricht die Empirie, die beispielsweise Haas und Killias (2001) vorgelegt haben. Sie untersuchten die Lebenslage von Vergewaltigern. Ihr verblüffendes Ergebnis: Trotz ihrer schweren Devianz sind viele Vergewaltiger nach äußeren Maßstäben sozial integriert.
• 70 % haben eine feste Arbeitsstelle.
• 67 % haben eine Berufslehre oder eine höhere Ausbildung abgeschlossen.
• 60 % haben schon einmal eine feste Freundin gehabt.
• 40 % sind Mitglied in einem Verein.
Ihr Fazit: Wir »müssen davon ausgehen, dass es eine große Gruppe von Vergewaltigern gibt, welchen es gelingt, sich äußerlich anzupassen« (Haas & Killias 2001, 214).
Wenn man also die Rückfallgefahr allein an diesen äußeren Gegebenheiten festmachen würde, könnte man mögliche Rückfallgefahren nicht erkennen und – was für den oben genannten Auftrag fatal wäre – man würde nicht daran arbeiten. Wer das »doppelte Mandat« also ernst nimmt, kann bei aller Notwendigkeit und Unverzichtbarkeit des Hilfeauftrages nicht darüber hinwegsehen, dass mit Hilfe und Stabilisierung von Lebenslagen alleine in vielen Fällen noch kein ausreichender Beitrag zur Rückfallprävention geleistet wird. Oder noch genauer: Man wird nicht umhinkommen, genau hinzusehen, wo in jedem einzelnen Fall die rückfallrelevanten Faktoren zu suchen sind.
3.5 Sozialräumliche Ansätze
Bisweilen wird das Fehlen sozialräumlicher Ansätze in der Justizsozialarbeit zu Recht angeprangert (z. B. Grosser 2018a). Tatsächlich gehört es im Sinne des ökosozialen Ansatzes (  Kap. 2.2.1) zum Auftrag Sozialer Arbeit, nicht nur das Verhalten von straffällig gewordenen Menschen zu fokussieren, sondern auch die sozialräumlichen Verhältnisse entsprechend zu gestalten.
Kap. 2.2.1) zum Auftrag Sozialer Arbeit, nicht nur das Verhalten von straffällig gewordenen Menschen zu fokussieren, sondern auch die sozialräumlichen Verhältnisse entsprechend zu gestalten.
Ohne hier bereits die ökologischen Kriminalitätstheorien vorwegnehmen zu wollen (  Kap. 4.3), sei an dieser Stelle schon ein kleiner Vorgriff gewagt. In dem weit verbreiteten Werk »Kriminologie« widmet sich Schwind in einem Kapitel Korrelationen zwischen »Wohnumwelt und Kriminalität«. Er thematisiert darin u. a. Themen der Kriminalgeografie, z. B. die Zusammenhänge zwischen Raumstruktur und Kriminalität oder auch zwischen Wohnhausarchitektur und Kriminalität. Er sieht in diesen Phänomenen zwar keine direkten kausalen Beziehungen, wohl aber in der Kumulation von Benachteiligungen, Abbau von sozialer Kontrolle und strukturellen Defiziten (z. B. Hilfemöglichkeiten) Faktoren, die in komplexen Wechselwirkungen zu einer ungünstigen Sozialstruktur führen (z. B. hohe Arbeitslosigkeit in Quartieren mit überdurchschnittlich hoher Kriminalitätsbelastung) und dadurch Kriminalität durchaus begünstigen können. Aus seiner Sicht ist eine kommunale Kriminalprävention – im Sinne einer sozialräumlichen Umgestaltung – durchaus als (neue) gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen (Schwind 2010). Schwind knüpft damit an ältere kriminologische Annahmen an, die unter dem Titel »Defensible Space« (z. B. von Oscar Newman) schon in den 1970er Jahren veröffentlicht wurden und in denen beklagt wird, dass moderne Bauten lebensfeindlich seien und die Bewohner*innen dazu verleiten würden, diese zu zerstören (vgl. Schwind 2010, 328). Ebenso scheint die These der Chicagoer Schule durch, die schon in den 1930er Jahren kriminalitätsfördernde Strukturen in der Wohnumgebung an fehlender informeller Sozialkontrolle festgemacht hat (Oberwittler 2013, 47). Der ebenfalls klassische »Broken-Windows«-Ansatz, der aufzeigt, wie das alltägliche Erleben von Vermüllung und zerbrochenen Fensterscheiben zu einer allmählichen Resignation, abnehmender Sozialkontrolle und in der Folge steigender Kriminalität im öffentlichen Raum führen (Wilson & Kelling 1982), ist ebenfalls ein Beleg dafür, dass der umfassende sozialarbeiterische Ansatz einer Lebens- bzw. Sozialraumgestaltung zukunftsfähig ist. Wenn es also zum Proprium Sozialer Arbeit gehört, auch Verhältnisse zu verändern, dann gehört die sozialräumliche Komponente mit dem Ziel einer Reduktion von Kriminalitätsfurcht und urbaner Ordnung zweifellos zu ihrem Auftrag.
Kap. 4.3), sei an dieser Stelle schon ein kleiner Vorgriff gewagt. In dem weit verbreiteten Werk »Kriminologie« widmet sich Schwind in einem Kapitel Korrelationen zwischen »Wohnumwelt und Kriminalität«. Er thematisiert darin u. a. Themen der Kriminalgeografie, z. B. die Zusammenhänge zwischen Raumstruktur und Kriminalität oder auch zwischen Wohnhausarchitektur und Kriminalität. Er sieht in diesen Phänomenen zwar keine direkten kausalen Beziehungen, wohl aber in der Kumulation von Benachteiligungen, Abbau von sozialer Kontrolle und strukturellen Defiziten (z. B. Hilfemöglichkeiten) Faktoren, die in komplexen Wechselwirkungen zu einer ungünstigen Sozialstruktur führen (z. B. hohe Arbeitslosigkeit in Quartieren mit überdurchschnittlich hoher Kriminalitätsbelastung) und dadurch Kriminalität durchaus begünstigen können. Aus seiner Sicht ist eine kommunale Kriminalprävention – im Sinne einer sozialräumlichen Umgestaltung – durchaus als (neue) gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen (Schwind 2010). Schwind knüpft damit an ältere kriminologische Annahmen an, die unter dem Titel »Defensible Space« (z. B. von Oscar Newman) schon in den 1970er Jahren veröffentlicht wurden und in denen beklagt wird, dass moderne Bauten lebensfeindlich seien und die Bewohner*innen dazu verleiten würden, diese zu zerstören (vgl. Schwind 2010, 328). Ebenso scheint die These der Chicagoer Schule durch, die schon in den 1930er Jahren kriminalitätsfördernde Strukturen in der Wohnumgebung an fehlender informeller Sozialkontrolle festgemacht hat (Oberwittler 2013, 47). Der ebenfalls klassische »Broken-Windows«-Ansatz, der aufzeigt, wie das alltägliche Erleben von Vermüllung und zerbrochenen Fensterscheiben zu einer allmählichen Resignation, abnehmender Sozialkontrolle und in der Folge steigender Kriminalität im öffentlichen Raum führen (Wilson & Kelling 1982), ist ebenfalls ein Beleg dafür, dass der umfassende sozialarbeiterische Ansatz einer Lebens- bzw. Sozialraumgestaltung zukunftsfähig ist. Wenn es also zum Proprium Sozialer Arbeit gehört, auch Verhältnisse zu verändern, dann gehört die sozialräumliche Komponente mit dem Ziel einer Reduktion von Kriminalitätsfurcht und urbaner Ordnung zweifellos zu ihrem Auftrag.
Literatur zum Weiterlesen



Klug, W. & Schaitl, H. (2012): Soziale Dienste der Justiz. Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis. DBH (Hg.). Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg.
Uslucan, H.-H. (2012): Familiale Einflussfaktoren auf delinquentes Verhalten Jugendlicher. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 62 (49/50), 22–27.
Zobrist, P. & Kähler, H. D. (2017): Soziale Arbeit in Zwangskontexten. Wie unerwünschte Hilfe erfolgreich sein kann (3., vollst. überarb. Aufl.). München/Basel: Reinhardt.
Читать дальше
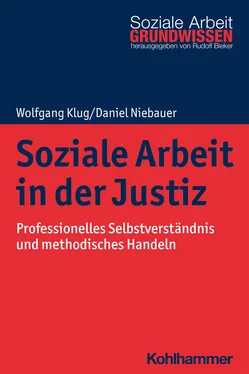
 Kap. 2.2.1) zum Auftrag Sozialer Arbeit, nicht nur das Verhalten von straffällig gewordenen Menschen zu fokussieren, sondern auch die sozialräumlichen Verhältnisse entsprechend zu gestalten.
Kap. 2.2.1) zum Auftrag Sozialer Arbeit, nicht nur das Verhalten von straffällig gewordenen Menschen zu fokussieren, sondern auch die sozialräumlichen Verhältnisse entsprechend zu gestalten.












