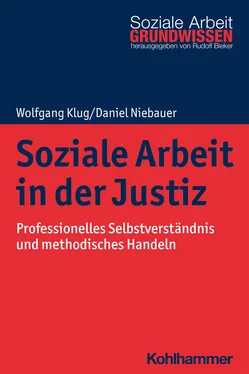Ein weiteres kommt hinzu. Im Bild der Öffentlichkeit wird es immer wichtiger, darzulegen, was die Aufgabe Sozialer Arbeit in einem bestimmten Arbeitsfeld ist. Der Berufsverband der US-amerikanischen Bewährungshilfe (Appa) bringt die Frage der Zielklarheit auf den Punkt:
»In recent years there has been a significant transformation in the forces demanding change in community corrections. […] Together they represent a demand for governmental organizations that can clearly articulate their mission in life, identify the goals they intend to achieve, and define the methods required to produce effective and measurable results. Government organizations, including community corrections, can no longer lay claim to shrinking public resources by simply claiming success; they must be able to demonstrate that they add value to the commonweal in a fashion desired by its citizenry« (Appa 2009, zit. in Klug & Schaitl 2012, 21).
3.2 Das »doppelte Mandat« als Grundlage der Sozialen Arbeit im Feld der Justiz
Wie bereits erwähnt ist aus unserer Sicht das sogenannte »doppelte Mandat« grundlegend für die Soziale Arbeit insgesamt und für die Soziale Arbeit in der Justiz im Besonderen.
In nahezu allen Lehrbüchern Sozialer Arbeit lassen sich Formulierungen finden, wie wir sie im Folgenden dem Lehrbuch von Johannes Schilling und Susanne Zeller entnehmen:
Das doppelte Mandat: Hilfe und Kontrolle
»Die zu erbringenden Dienstleistungen im Bereich Soziale Arbeit werden in der Regel mit dem Begriff ›doppeltes Mandat‹ bezeichnet. In dem doppelten Mandat wird die Funktionsbestimmung von Sozialer Arbeit recht gut zusammengefasst. Es geht darum, ein stets gefährdetes Gleichgewicht zwischen den Rechtsansprüchen, Bedürfnissen und Interessen der Zielgruppe einerseits und den jeweils verfolgten sozialen Kontrollinteressen des Staates andererseits zu halten (Hamburger 2003, 87). Kurz gesagt: Es geht einerseits um Hilfe und andererseits um Kontrolle. Ziel von Hilfe und Kontrolle sind Anpassung und Integration. Diese janusköpfige Gestalt löst immer wieder Diskussionen über das Berufsbild und die Berufsethik der Sozialen Arbeit aus. Doch gilt festzuhalten: Solange Soziale Arbeit im öffentlichen Auftrag handelt und sich in öffentlichen Organisationen vollzieht, ist das doppelte Mandat strukturell unvermeidbar und geradezu konstitutiv für die Berufsrolle« (Schilling & Zeller 2007, 263).
Die Einschätzung, dass das »doppelte Mandat« unvermeidbar und geradezu konstitutiv für das Verständnis von Sozialer Arbeit in der Justiz ist, deckt sich mit den Ausführungen zu unserem Theorieverständnis im vorherigen Kapitel.
Zur definitorischen und inhaltlichen Klarheit ist es nun nötig, die beiden zentralen Begriffe »Hilfe« und »Kontrolle« in den Kontext der Sozialen Arbeit im Feld der Justiz zu stellen.
Was meinen wir fachlich, wenn wir von »Hilfe« sprechen? Eine sehr gut nachvollziehbare Definition legt Haselmann vor:
»Die Kategorie Hilfe setzt voraus, dass es ein Hilfeersuchen gibt, d. h. (professionelles) Helfen ist eine ›Reaktion auf Bitte um Hilfe‹ (Ludewig 1998, 7). Kennzeichnend hierfür ist, dass der Hilfesuchende zugleich Auftraggeber und Empfänger der Hilfeleistung ist. Anders ist es bei der Kategorie ›Fürsorge‹. Diese erfolgt nach Maßgabe der Anordnung durch einen Dritten (etwa eine soziale Instanz). Das heißt der Fürsorge-Empfänger ist nicht zugleich der Auftraggeber der fürsorgenden Dienstleistung, ggf. lehnt er sie sogar ab; u. U. wird ihm die Fürsorge gegen seinen Willen aufgezwungen ›zu seinem Wohle‹ oder zum Schutze anderer. Die Kontrolle, die immer eine (u. U. gewaltsame) Einschränkung der Selbstbestimmung des Betroffenen bedeutet (z. B. Zwangseinweisung) wird somit von dem Autor unter die Kategorie der (bevormundenden) Fürsorge subsumiert« (Haselmann 2009, 187; Herv. i. O.).
Hilfe bezeichnet also alle methodischen Vorgehensweisen der Sozialen Arbeit, die auf Bitten von Klient*innen erfolgen. Nur diese selbst können entscheiden, ob und welche Hilfe sie wollen. In diesen auf Freiwilligkeit und Kooperation beruhenden Arbeitsformen sind Aushandeln, gemeinsame Zielplanung, arbeitsteiliges Vorgehen die adäquate und angemessene Vorgehensweise. Die Frage der Motivation spielt in Krisensituationen sicherlich eine Rolle, entscheidend ist sie nicht, denn der*die Klient*in erklärt den ausdrücklichen Willen zur Kooperation. Für die Freie Straffälligenhilfe ist »Hilfe« also der generelle Modus (und grundlegende Voraussetzung) ihrer Arbeit mit Klient*innen.
Haselmann grenzt davon den Begriff der Fürsorge ab. Diese ist dann angezeigt, wenn ein Mensch sich selbst nicht helfen kann, ja nicht mehr in der Lage ist, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ob er Hilfe braucht. Denken können wir dabei an kleine Kinder oder demente Personen, aber auch Menschen in akuten Krisensituationen wie z. B. psychotischen Episoden. Hier können wir nicht immer davon ausgehen, dass eine überlegte Entscheidung über die Einleitung von Hilfe getroffen werden kann. Vielmehr ist eine Intervention, z. B. Versorgung mit Nahrungsmitteln, geschlossene Einrichtung zum eigenen Schutz etc., angezeigt. Die »Anordnung durch einen Dritten« wäre beispielsweise die gerichtliche Bestellung einer gesetzlichen Betreuung.
Aus unserer Sicht ist der entscheidende Unterschied zwischen Hilfe und Kontrolle der Grad der Freiwilligkeit. Kontrollinterventionen sind von Klient*innen nicht verlangt, ja sie sind aus deren Sicht sogar freiheitsreduzierend. Auftraggeber ist nicht der*die Klient*in selbst, sondern die Gesellschaft, die ihren Auftrag zur Normalisierung der Betroffenen vermittelt durch die Justiz oder das Jugendamt. Kontrollinterventionen sind also nur in gesetzlich verfassten Zwangskontexten möglich. Wir möchten im Hinblick auf das zu behandelnde Arbeitsfeld Zwangskontexte definieren, wie Zobrist und Kähler es vorschlagen.
Was ist ein Zwangskontext?
»Zwangskontexte sind strukturelle Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit, die zu eingeschränkten Handlungsspielräumen bei Klienten, Fachkräften und Zuweisern führen und durch institutionelle Sanktionsmöglichkeiten sowie asymmetrische Machtverhältnisse gekennzeichnet sind. Die Interaktionen zwischen Klienten und Fachkräften konstituieren sich aufgrund rechtlicher Normen und finden i. d. R. fremdinitiiert statt. In Zwangskontexten werden teilweise Zwangselemente eingesetzt, welche die Autonomie der Klienten erheblich beschränken« (Zobrist & Kähler 2017, 31).
Kontrollinterventionen im Sinne der Durchsetzung von Normalisierungsansprüchen der Gesellschaft kommen bisweilen auch deshalb in die Kritik, weil ihnen mangelnde Erfolgsaussichten bescheinigt werden. So schreibt etwa Trotter zu Recht:
»Interventionen, die nicht auf die von KlientInnen erreichbaren oder gemeinsam vereinbarten Ziele, sondern auf die Ziele der SozialarbeiterIn hinarbeiten, scheinen ebenfalls keine Erfolgschancen zu haben« (Trotter 2001, 151).
In der Tat wissen wir, dass Motivation zur Selbstveränderung notwendig ist, damit Menschen sich tatsächlich im von der Gesellschaft erwünschten Sinne verändern. Ebenso wissen wir, dass Repression und Bestrafung zu Widerständen führen (vgl. Zobrist & Kähler 2017, 39f.). Dieses empirische Wissen kann jedoch nicht dazu verwendet werden, Zwangskontexte generell abzulehnen. Zum einen ist und bleibt das Ziel einer Normalisierung eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, zum anderen ist es eine methodische Frage, wie innerhalb des Zwangskontextes mit Klient*innen umgegangen wird. Wer hier ausschließt, dass in diesem Kontext Motivation durch Motivationsarbeit entstehen kann, und wer postuliert, dass nur in freiwilligen Kontexten eine helfende Beziehung entstehen kann, spricht nicht nur Pflichtklient*innen ihre Veränderungsmöglichkeit ab und macht diese Zielgruppe zu einer »Hard-to-Reach«-Zielgruppe, sondern bestreitet auch entgegen der Empirie (vgl. beispielsweise Miller/Rollnick 2015) die Erfolgsaussichten von motivierenden Interventionen.
Читать дальше