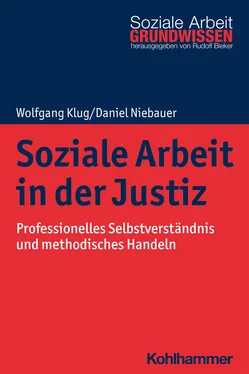Werden diese stetigen Wechselwirkungen von Individuum und Umwelt zum zentralen Gegenstand, stellt sich also immer die Frage, wie die jeweiligen Umweltgegebenheiten und die Möglichkeiten des Individuums zusammenpassen oder zusammenfinden. Germain und Gitterman benutzen hierfür den Terminus »Abstimmung von Person und Umwelt«. Ist die Abstimmung von Person und Umwelt gut, wird die Entwicklung des Individuums nicht behindert und die Umwelt nicht geschädigt. Sind die Bedürfnisse und Wünsche des Individuums und seine Umwelt schlecht aufeinander abgestimmt, können soziale Probleme entstehen.
Soziale Probleme entstehen demnach dann, wenn die Bedürfnisse der Person durch die Umwelt nicht befriedigend erfüllt sind und die Person mit den ihr zur Verfügung stehenden individuellen Ressourcen nicht in der Lage ist, sich die entsprechenden Umweltressourcen zu verschaffen. Ein ungünstiges Anpassungsverhältnis zwischen Bedürfnissen und Bewältigungsweisen (Coping) der Menschen und den Charakteristika der Umwelt erzeugt Stress. Interner Stress ist nach Germain und Gitterman ein Symptom für negative Beziehungen zwischen der Person und der Umwelt. Germain & Gitterman (1999, 156) betonen:
»Wie gut Menschen Streß bewältigen können, hängt weitgehend von dem zwischen externen und internen Ressourcen bestehenden Anpassungsgleichgewicht ab.«
Die Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es nun, die Bewältigung sozialer Probleme dadurch zu unterstützen, indem einerseits dem Individuum die Anpassung an die Umwelt ermöglicht wird und deren Ressourcen erschlossen werden können, andererseits aber auch die Empfänglichkeit der Umwelt für das Individuum gefördert wird. Diese theoretische Perspektive ist gleichzeitig auf der Handlungsebene der Ansatzpunkt für Case Management, das zum Ziel hat, soziale Probleme durch optimale Allokation, Einbeziehung und Koordination von Umweltressourcen zu lösen.
Wendt (1990) führt in seiner Adaption des ökosozialen Ansatzes bewusst den aus ökonomischen Zusammenhängen stammenden Begriff des »Management« ein, der wie folgt verstanden werden kann:
»Analog ›managt‹ ein einzelner Mensch seine Alltagsangelegenheiten, wenn er sie in großen Zügen auf Ziele und Zwecke hin besieht und auslegt, um dann Vorrangiges von Nachrangigem zu unterscheiden und den Zeit- und Mitteleinsatz entsprechend einzurichten« (ebd., 122).
Für dieses persönliche (Selbst-)Management stehen jedem Menschen innere und äußere Ressourcen zur Verfügung, die er in seiner je eigenen Lebenswelt gebrauchen kann, um die Anforderungen zu bewältigen, die sich stellen. In Anlehnung an Rice und Tucker (zit. in Wendt 1990, 61) können dies sein:
• »personal characteristics,
• environmental qualities,
• natural resources,
• community facilities,
• resources include all possessions,
• human capabilities and environmental characteristics that are on hand or in reserve and available for use and development.«
Gelingt es, die inneren und äußeren Ressourcen so zu nutzen, dass die Anpassungsleistung zu für den*die Einzelne*n befriedigenden Ergebnissen führt, folgt daraus persönliches Wachstum und Zufriedenheit. Gelingt dies nicht, kommt es zu mangelhaftem Ressourcenmanagement. Dies kann bei gefährdeten Menschen zu chronischen psychosomatischen Erkrankungen, zu destruktiven Anpassungsversuchen (z. B. Sucht) oder anderen akuten Problemen führen. Auch Kriminalität ist aus ökosozialer Perspektive ein Zeichen mangelnder Abgestimmtheit zwischen Person und Umwelt. Entscheidend dabei ist zu sehen, dass die akute Krise ihre Ursachen in der mangelnden Alltagsführungskompetenz in Verbindung mit fehlenden oder nicht zugänglichen Ressourcen des Umfeldes hat. Zu vermeiden sind allerdings einseitige ›Schuldzuweisungen‹: Weder der Einzelne ist (alleine) schuld an seiner Situation, noch die Umwelt ist (alleine) verantwortlich zu machen, vielmehr rückt die entsprechende Wechselwirkung von Person und Umwelt in den Fokus.
Aus diesen grundlegenden Annahmen ergibt sich folgende (ökosoziale) Hilfestrategie: Es muss gelingen, in einem für Klient*innen überschaubaren Hilfeprozess diese in die Lage zu versetzen, das eigene Lebensmanagement mit den verschiedenen Facetten (ökonomische Komponente, Beziehungen, Freizeitbeschäftigung, Arbeit, Wohnen) in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus gilt es, sie zu befähigen, die sich zukünftig stellenden Herausforderungen strategisch, d. h. langfristig planend, anzugehen. Dabei darf nie die Einbettung der Klient*innen in ihre Umwelt vergessen werden. Soziale Arbeit in einem ökosozialen Verständnis findet deshalb auf drei Systemebenen statt (Mühlum 1994; Wendt 1990, 19).
• Auf der Mikrosystem-Ebene:
Diese Ebene betrifft die Person des*der Klient*in und sein*ihr unmittelbares Umfeld.
• Auf der Mesosystem-Ebene:
Diese Ebene zielt auf die soziale Nahumwelt, Freund*innen, Bekannte, Gruppen und Kreise, sowie die soziale Infrastruktur.
• Auf der Makrosystem-Ebene:
Diese Ebene betrifft die überregionalen Systeme wie das Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialsystem.
Erst in der dritten Auflage haben Germain & Gitterman (1999) Meso- und Makrosystem sowie Überlegungen zum Einfluss der Organisationen auf die Hilfegestaltung aufgenommen. Neben der Arbeit mit dem Mikrosystem, also der Verhaltens- und Einstellungsänderung von Klient*innen, sind es die »Verhältnisse«, die zunächst auf der Mesoebene einer Veränderung unterzogen werden müssen. Damit wird die Gemeinde (Community) zum Ort sozialarbeiterischer und folglich politischer Arbeit. Germain & Gitterman begründen dies wie folgt:
»Der Mangel an Ressourcen in einer Gemeinde (community), Probleme bei der Koordination der Gemeinde-Ressourcen oder Schwierigkeiten beim Zugang zu vorhandenen Ressourcen können Lebensstressoren darstellen oder verschärfen. Um die Lebensqualität von Gemeinden und Nachbarschaft zu verbessern, ist es erforderlich, dass SozialarbeiterInnen, die ihre Praxis nach dem Life Model ausrichten, ein bestimmtes Wissen und methodisches Können für die Gemeinwesenarbeit (community work) erwerben« (Germain & Gitterman 1999, 502).
Für die sozialarbeiterische Arbeit auf der Makroebene bedeutet dies, dass Kenntnisse im Bereich der Entstehung von Gesetzen sowie vorhandener Gesetze erforderlich sind. Hinzu kommt das Wissen, das benötigt wird, um die politische Entwicklung zu beeinflussen. Wie kommen Gesetze und Verordnungen zustande? Welche Methoden und Fertigkeiten benötigen Sozialarbeiter*innen, um auf dieser Ebene Veränderungen herbeiführen zu können?
Eine professionelle Aufgabe und Funktion der Sozialen Arbeit auf der Makroebene muss nach dem Life Model eine Art Anwaltschaftlichkeit gegenüber Gemeinden, Organisationen und dem Staat sein. Wenn Sozialarbeiter*innen als Fürsprecher*innen für ihre Klient*innen auftreten, müssen sie die professionellen und persönlichen Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, abschätzen. Um politisch tätig werden zu können, müssen sie sich im Klaren darüber sein, welche Unterstützung sie seitens der eigenen Organisation und des eigenen Verbandes erhalten, um mit den möglichen Konsequenzen umgehen zu können. Diese Haltung wird in der US-amerikanischen Fachliteratur Advocacy genannt.
Advocacy meint die »parteiische Intervention im Interesse eines individuellen Klienten oder einer identifizierten Gruppe« (Ewers 2000, 63) und wird in der US-amerikanischen Diskussion sowohl auf der Klient*innen- als auch auf der politischen Ebene verwendet.
In unseren Überlegungen wird dieser Begriff noch häufiger auftauchen und in vielfältiger Weise interpretiert werden.
Auch wenn andere Autor*innen des ökosozialen Ansatzes bedeutend zurückhaltender sind mit ihrem Anspruch auf Veränderung von Makrosystemen (z. B. Mühlum, Bartholomeyczik & Göpel 1997, 194), bleibt doch die Forderung an die Sozialarbeit, »systemgestaltend« zu wirken (Mühlum 1994, 14).
Читать дальше