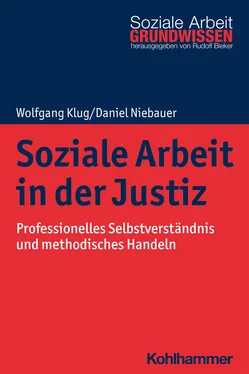Beispiel: Oberlandesgericht München – Aufgaben der Gerichtshilfe
»Aufgabe der Gerichtshilfe ist es, Staatsanwaltschaften und Gerichten in verschiedenen Stadien des Ermittlungs-, Straf- und Strafvollstreckungsverfahrens durch Berichte zur Persönlichkeit und dem Umfeld erwachsener Straffälliger wichtige Entscheidungshilfen zu geben. Die Gerichtshilfe
stellt die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse von Beschuldigten
und Verurteilten fest,
klärt die Gründe für Auflagen- und Weisungsverstöße,
wirkt mit Mitteln der Sozialarbeit an der Resozialisierung straffällig gewordener Menschen mit und
überprüft Gnadengründe.
Im Ermittlungsverfahren leistet die Gerichtshilfe damit einen Beitrag zur
Bestimmung täterbezogener Rechtsfolgen,
Entscheidung für eine Bewährungsunterstellung,
Ergänzung gerichtsmedizinischer und psychiatrischer Begutachtungen und
Einleitung bzw. Vermittlung erster Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen.
Im Vollstreckungsverfahren trägt die Gerichtshilfe dazu bei
Bewährungsauflagen an die Lebenswirklichkeit der Verurteilten anzupassen,
den gerichtlichen Entscheidungen Nachdruck zu verleihen und
vermeidbare Bewährungswiderrufe und damit Haftverbüßung abzuwenden.
(…)
Gerichtshelfer*innen sind organisatorisch den Staatsanwaltschaften oder den Landgerichten unterstellt.« (Quelle: Oberlandesgericht München o. J.).
Neben den genannten, gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben der Gerichtshilfe als Ermittlungs- und Entscheidungshilfe im Strafverfahren hat sich das Tätigkeitfeld der Gerichtshilfe in den vergangenen Jahren erheblich erweitert. So kann die Gerichtshilfe auch als Haftentscheidungs- bzw. Haftverkürzungshilfe fungieren, wenn Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen werden. In diesem Fall hilft die Gerichtshilfe bei der Einschätzung, ob Fluchtgefahr besteht oder eine Haftverschonung oder Verkürzung der Untersuchungshaft möglich ist. Die Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen kann ebenfalls in einigen Bundesländern zu den Aufgaben der Gerichtshilfe zählen. Darüber hinaus kann auch die Opferberichterstattung ein Tätigkeitsgebiet der Gerichthilfe sein, womit die Würdigung der Opferseite im Rahmen des Strafverfahrens verbunden ist. Hierbei bringt die Gerichtshilfe Informationen zum Opfer einer Straftat in das Strafverfahren ein, wie z. B. die Lebenssituation des Opfers vor der Tat, die Beziehung zur Tatperson oder die Auswirkungen der Straftat auf das Opfer in physischer, psychischer und/oder materieller Hinsicht. Zudem informiert die Gerichtshilfe das Opfer über den Ablauf der Gerichtsverhandlung sowie über geeignete Hilfs- und Unterstützungsangebote, wie z. B. Opfereinrichtungen, Rechtsberatungsmöglichkeiten oder den Täter-Opfer-Ausgleich als Schadenswiedergutmachung. In einigen Regionen ist die Gerichtshilfe unmittelbar mit der Umsetzung des Täter-Opfer-Ausgleichs betraut, womit besondere Kompetenzen in der Konfliktberatung und Mediation notwendig sind (vgl. Kawamura-Reindl & Schneider 2015, 165f.; Thier 2018, 193f.).
Neben den oben dargestellten ambulanten Sozialen Diensten der Justiz ist Soziale Arbeit auch im stationären Kontext mit straffälligen Menschen anzutreffen. Der Strafvollzug – also der Vollzug einer Freiheitsstrafe – findet grundsätzlich in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) statt. Auch hier sind für die in Deutschland insgesamt 179 Justizvollzugsanstalten (Stichtag: 30.11.2018; vgl. Statista 2019) große institutionelle Unterschiede festzustellen. Unterbringungen können in unterschiedlichen Formen des geschlossenen oder offenen Vollzugs, in unterschiedlichen Wohn- bzw. Behandlungsgruppen oder in sozialtherapeutischen Abteilungen stattfinden. Zudem sind wesentliche Unterschiede bei einer Untersuchungshaft sowie der Unterbringung im Maßregelvollzug zu verzeichnen (vgl. Kawamura-Reindl & Schneider 2015, 233; eine ausführliche Darstellung des Strafvollzugs findet sich u. a. bei Laubenthal 2019).
Am Stichtag 31.03.2020 befanden sich 59 487 Gefangene (Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden oder zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe verurteilt wurden) und Verwahrte (Personen, die unter Sicherungsverwahrung oder sonstigen Freiheitsentzug gestellt wurden) in Justizvollzugsanstalten. Davon verbüßten 42 177 Personen (39 637 Männer und 2 540 Frauen) eine Haftstrafe im Erwachsenenvollzug und 12 251 Personen (11 640 Männer und 611 Frauen) waren in Untersuchungshaft (vgl. Statista 2020a; 2020b).
Die zentralen Rechtsgrundlagen ergeben sich aus dem 1977 in Kraft getretenen Strafvollzugsgesetz (StVollzG), insbesondere den §§ 2, 3 StVollzG.
§ 2 StVollzG: Aufgaben des Vollzuges
Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten.
§ 3 StVollzG: Gestaltung des Vollzuges
(1) Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden.
(2) Schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges ist entgegenzuwirken.
(3) Der Vollzug ist darauf auszurichten, daß er dem Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit einzugliedern.
Wenngleich seit der Föderalismusreform 2006 die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug auf die Bundesländer übertragen wurde (siehe die einzelnen Landesstrafvollzugsgesetze; guter Überblick in Dünkel & Pruin 2015) und dadurch zum Teil der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten an die erste Stelle gesetzt wurde (vgl. z. B. Bayerisches Strafvollzugsgesetz; BayStVollzG), stellt § 2 StVollzG das Ziel der Resozialisierung für jede*n Gefangene*n in den Mittelpunkt, das auch durch das Bundesverfassungsgericht entsprechend bestätigt wurde. Die Resozialisierung stellt somit die Zielvorgabe für alle Bereiche und Berufsgruppen im Strafvollzug dar, auf das gemeinsam (und nach § 154 StVollzG auch in Zusammenarbeit mit Stellen und Behörden außerhalb des Strafvollzugs, wie z. B. der Bewährungshilfe, der Agentur für Arbeit, den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege) und verpflichtend hinzuwirken ist (vgl. Cornel 2018b, 310; Kawamura-Reindl & Schneider 2015, 235f.; Laubenthal 2019, 116ff.). Das Vollzugsziel der Resozialisierung wird gemäß § 3 StVollzG durch die folgenden Gestaltungsprinzipien konkretisiert:
• durch den Angleichungsgrundsatz (§ 3 Abs. 1 StVollzG),
• den Gegensteuerungsgrundsatz (§ 3 Abs. 2 StVollzG) und
• den Integrationsgrundsatz (§ 3 Abs. 3 StVollzG).
Diese Grundsätze der Gestaltung des Strafvollzugs sollen dazu verpflichten, dass das Leben der Gefangenen in einer totalen Institution (Goffman 1981) an menschenwürdige Lebensverhältnisse anzugleichen ist (Laubenthal 2019, 147).
»Eine totale Institution wie die Justizvollzugsanstalt kennzeichnen nach Goffman folgende zentrale Merkmale:
1. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle unter ein und derselben Autorität statt.
2. Die Mitglieder der Institution führen sämtliche Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen.
3. Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Abfolge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben.
4. Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen« (Laubenthal 2019, 147).
Читать дальше