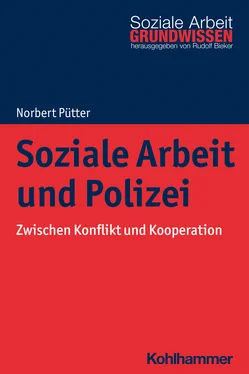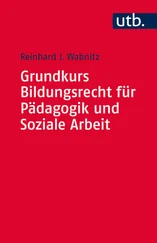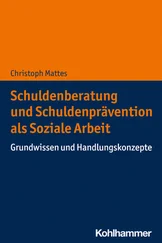Als infolge des Volkszählungsurteils die Innenministerkonferenz den Musterentwurf für die Polizeigesetze überarbeitete, wurde zugleich dem präventiven Anspruch in der Aufgabenbestimmung Rechnung getragen. In den Landespolizeigesetzen heißt es seither – nahezu gleichlautend:
»Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Sie hat im Rahmen dieser Aufgaben auch für die Verfolgung von Straftaten vorzusorgen und Straftaten zu verhüten (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) sowie Vorbereitungen zu treffen, um künftige Gefahren abwehren zu können (Vorbereitung auf die Gefahrenabwehr).«
Innenministerkonferenz (IMK)
Die »Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder« ist die zentrale Einrichtung, durch die eine gewisse Einheitlichkeit in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland gewährleistet werden soll. Die IMK koordiniert die Innenpolitik der Bundesländer, indem sie einerseits innenpolitische Initiativen auf den Weg bringt und andererseits die Verwaltungspraxis harmonisiert. Die regelmäßigen Ministertreffen sind nur die oberste Ebene der IMK-Arbeit. Zu beliebigen Themen kann die IMK Projektgruppen oder Kommissionen bilden, die durch FachbeamtInnen besetzt sind. Für die Polizei zentral ist der »Arbeitskreis II – Innere Sicherheit« (AK II).Der AK II verfügt wiederum über dauerhafte Untergliederungen. Besonders wichtig ist die »Vorschriftenkommission«, denn sie erarbeitet die »Polizeidienstvorschriften« (PDVs), die verbindliche Vorgaben für das polizeiliche Handeln enthalten (s. Pütter 2000; IMK 2020).
Durch die Erweiterung des Gefahrenabwehrbegriffs wird der Tätigkeitsbereich der Polizei erheblich vergrößert. Denn es ist offenkundig, dass eine »vorbeugende Bekämpfung« sich von der »konkreten Gefahr« als Einsatzschwelle lösen muss. Wenn Straftaten in der Zukunft verhindert werden sollen, kann dies nicht erst dadurch geschehen, dass die Polizei im Einzelfall so lange zuwartet, bis die Straftat kurz vor der Vollendung steht. Vielmehr muss die Polizei, will sie den präventiven Auftrag ernst nehmen, sich mit dem »Vorfeld« strafbarer Handlungen, also mit den sozialen Kontexten von Kriminalität befassen.
Im März 2018 begann mit der Novellierung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes eine weitere Ausdehnung polizeilicher Zuständigkeiten. Durch den neuen Begriff der »drohenden Gefahr« wurden polizeiliche Eingriffe im weiten Vorfeld »konkreter Gefahren« legalisiert. Die neue Bestimmung erlaubt der bayerischen Polizei die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn
»im Einzelfall … Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen den Schluss auf ein seiner Art nach konkretisiertes Geschehen zulassen, wonach in absehbarer Zeit Angriffe von erheblicher Intensität oder Auswirkung zu erwarten sind« (Art. 11 Abs. 3 PAG Bayern).
Diese Ausdehnung ist im Kontext der Terrorismusbekämpfung entstanden. Sie zielt auf Personen, die mittlerweile »Gefährder« genannt werden, also weder »Störer« (= VerursacherIn einer konkreten Gefahr) noch StraftäterIn bzw. Tatverdächtige sind. Die gesetzliche Formulierung beschränkt die Anwendung keineswegs auf die Abwehr terroristischer Gefahren. Insofern stellt sie den jüngsten Schritt dar, durch den die polizeilichen Zuständigkeiten auf potenziell gefahrenträchtige soziale Sachverhalte erweitert werden (s. Ruschemeier 2020).
1.1.3 Strafverfolgung/übertragene Aufgaben
In den Aufgabenbeschreibungen der Polizeigesetze finden sich zwei weitere Bestimmungen. Die erste betrifft die »Vollzugshilfe«. In § 1 Abs. 3 des Musterentwurfs heißt es: »Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe.« Dass die Polizei andere Behörden in der Wahrnehmung deren Aufgaben auf deren »Ersuchen« (= Antrag) hin unterstützt, wird in § 25 des Musterentwurfs an die Bedingungen gebunden, dass »unmittelbarer Zwang anzuwenden ist und die anderen Behörden nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen können.« In der Verpflichtung zur Vollzugshilfe schlägt sich der Umstand nieder, dass der Staat mit der Polizei eine Einrichtung geschaffen hat, die über die Fähigkeit verfügt, physische Gewalt (= unmittelbarer Zwang) auszuüben. Es ist deshalb folgerichtig, dass Behörden, die über diese Fähigkeit nicht verfügen, von der Polizei unterstützt werden.
Neben dieser explizit in den Polizeigesetzen formulierten Verpflichtung gilt das in Art. 35 GG formulierte Gebot der Amtshilfe (»Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und Amtshilfe.«) auch für die Polizeien. Amtshilfe bedeutet, dass sich andere Behörden auch mit anderen als Vollzugsersuchen an die Polizei wenden können und die Polizei diesen Hilfsersuchen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nachkommen muss.
Die zweite Gruppe übertragener Polizeiaufgaben ergibt sich aus dem Satz: »Die Polizei hat die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind.« Die wichtigsten dieser anderen Rechtsvorschriften betreffen die Verfolgung von Straftaten und von Ordnungswidrigkeiten. Die Tätigkeiten der Polizei im Hinblick auf die Verfolgung von Straftaten (= Aufklärung und Ermittlungen von strafbaren Handlungen) richten sich nicht nach den Bestimmungen der Polizeigesetze, sondern nach denen der Strafprozessordnung (StPO) und des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG). Beide Gesetze sind Bundesgesetze, so dass sie in allen Bundesländern gelten.
Der Bedeutung des Gefahrenbegriffs als »Eingriffsschwelle« entspricht in der StPO die Formulierung »zureichende tatsächliche Anhaltspunkte«. Denn in § 152 Abs. 2 StPO heißt es:
»Sie (die Polizei) ist, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen.«
Dieser Satz schreibt die Strafverfolgungspflicht oder das Legalitätsprinzip fest. Für die Polizei bedeutet dies, PolizistInnen müssen ein Ermittlungsverfahren eröffnen, wenn ihnen »zureichende tatsächliche Anhaltspunkte« auf eine begangene Straftat bekannt werden.
Allerdings bezieht sich das »sie« in § 152 StPO nicht auf die Polizei, sondern auf die Staatsanwaltschaft. Hier liegt der zweite Unterschied zum Polizeirecht: Während es sich bei der Gefahrenabwehr um eine »originäre« Aufgabe handelt, wirkt die Polizei in der Strafverfolgung ›nur‹ im Auftrag. Denn die Leitung des Ermittlungsverfahrens liegt rechtlich von Beginn an bei der Staatsanwaltschaft. Dies wird auch an den Formulierungen des § 163 StPO deutlich, der die Aufgaben der Polizei benennt.
§ 163 Abs. 1 und 2 StPO: Aufgaben der Polizei im Ermittlungsverfahren
(1) Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu verhüten. Zu diesem Zweck sind sie befugt, alle Behörden um Auskunft zu ersuchen, bei Gefahr im Verzug auch, die Auskunft zu verlangen, sowie Ermittlungen jeder Art vorzunehmen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln.
(2) Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes übersenden ihre Verhandlungen ohne Verzug der Staatsanwaltschaft. Erscheint die schleunige Vornahme richterlicher Untersuchungshandlungen erforderlich, so kann die Übersendung unmittelbar an das Amtsgericht erfolgen.
Die Staatsanwaltschaft gilt als die »Herrin des Ermittlungsverfahrens«, dies gilt auch dann, wenn sie (noch) nicht weiß, dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Noch bis 2004 bezeichnete das GVG (es regelt Aufbau und Zuständigkeiten innerhalb des Gerichtssystems) PolizistInnen als »Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft« (§ 152). Mit der Ersetzung dieses Begriffs durch »Ermittlungspersonen« hat der Gesetzgeber versucht, der realen Bedeutung der Polizei im Ermittlungsverfahren gerecht zu werden. Die neue Bezeichnung änderte aber nichts an der rechtlichen Unterordnung, denn auch für die »Ermittlungspersonen« gilt weiterhin, dass sie »in dieser Eigenschaft verpflichtet (sind), den Anordnungen der Staatsanwaltschaft ihres Bezirks und der dieser vorgesetzten Beamten Folge zu leisten.« Im Normallfall der Alltagskriminalität ist die Staatsanwaltschaft an den polizeilichen Ermittlungen nicht beteiligt; sie wird erst über die Existenz des Verfahrens informiert, wenn ihr die Akten des polizeilich ausermittelten Falles zugestellt werden. Nur bei schweren Straftaten oder wenn besondere Ermittlungsmethoden der Polizei eingesetzt werden sollen, muss die Staatsanwaltschaft unmittelbar an den Polizeiermittlungen beteiligt werden.
Читать дальше