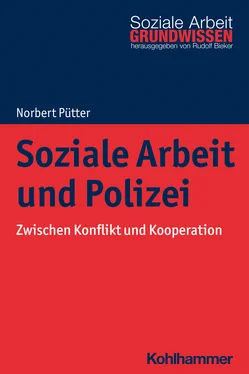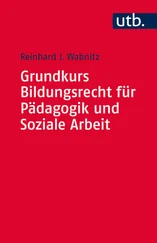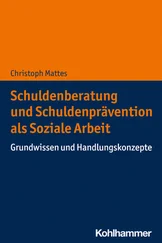»Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren.«
In fast allen Bundesländern beginnen die Polizeigesetze mit diesem Satz. Die zitierte Bestimmung begrenzt die Zuständigkeiten der Polizei, indem sie ihr die Aufgabe der Abwehr von Gefahren für bestimmte »Schutzgüter« zuweist: für die »öffentliche Sicherheit« und für die öffentliche »Ordnung«. Umgekehrt bedeutet das: Die Polizei ist nicht zuständig, wenn keine Gefahren im Raum stehen oder wenn diese Gefahren weder der öffentlichen Sicherheit noch der öffentlichen Ordnung gelten. Ob und inwieweit von dieser Aufgabenbestimmung tatsächlich eine Begrenzung ausgeht, hängt von der Bedeutung dieser Begriffe ab.
Der Begriff »öffentliche Sicherheit«, so ein anerkannter Polizeirechtskommentar, »ist außerordentlich weit.« Zum Beleg wird aus dem Bremischen Polizeigesetz (§ 2) zitiert, das »die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt« als »öffentliche Sicherheit« definiert (Denninger 2012, S. 192).
Im Einzelnen umfasst der Begriff
• die gesamte Rechtsordnung. »Grundsätzlich«, so Denninger, »berührt jede drohende oder bereits begangene Verletzung der Rechtsordnung die öffentliche Sicherheit.« Jede Straftat, jeder Verstoß gegen verwaltungsrechtliche Vorschriften stellt deshalb zugleich eine Gefährdung der »öffentlichen Sicherheit« dar.
• den Bestand des Staates und die »Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen« (etwa Parlamente, Behörden, Gerichte). Überwiegend sind die staatlichen Einrichtungen auch durch das Strafrecht, d.h. durch die Gerichtsbarkeit geschützt, so dass es sich hier um einen Spezialfall der »Rechtsordnung« handelt.
• die »Unverletzlichkeit … der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen«. Zu den Individualrechtsgütern zählen Vermögen, Eigentum und materielle Güter ebenso wie immaterielle Rechte (geistiges Eigentum z.B.); die subjektiven Rechte umfassen Menschenwürde, Ehre, Leben, Gesundheit und Freiheit. Sofern diese Rechtsgüter nicht durch das Strafrecht geschützt sind, ist die Polizei hier allerdings nur nachrangig (subsidiär) zuständig, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig möglich ist.
Der weite Raum, den die »öffentliche Sicherheit« eröffnet, wird durch den Bezug auf die öffentliche »Ordnung« noch vergrößert. Da bereits viele Lebenssachverhalte verrechtlicht sind, kann sich »Ordnung« nur auf jene »anerkannten sozialethischen Normen« beziehen, die (noch) nicht rechtlich geschützt sind. »Ordnung« ist deshalb ein offener Begriff, der anfällig dafür ist, von den jeweils dominierenden Anschauungen mit Inhalt gefüllt zu werden. In einer »kulturell, religiös, ethnisch und nach ihren Traditionen pluralistische(n) demokratische(n) Gesellschaft« (ebd., S. 200) sollte, so die Kritik, auf »Ordnung« als Eingriffsgrundlage für polizeiliches Handeln verzichtet werden. Wenige Bundesländer haben auf diese Kritik reagiert: In Bremen und in Schleswig-Holstein fehlt der Bezug auf die »Ordnung« in den Polizeigesetzen; in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen war er zeitweise gestrichen, ist dann aber wieder eingefügt worden (ebd., S. 199).
Die Polizei soll »Gefahren« für die genannten Schutzgüter abwehren; sie soll also verhindern, dass die Gefahr eintritt, dass die Schutzgüter Schaden nehmen. Deshalb ist die Gefahrenabwehr eine präventive Tätigkeit, die auf einer Prognose beruht. Diese Gefahr muss eine bestimmte Qualität oder Intensität erreicht haben, die im Polizeirecht als »konkrete Gefahr« bezeichnet wird. Sie liegt dann vor »wenn eine Sachlage oder ein Verhalten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit Wahrscheinlichkeit ein polizeilich geschütztes Rechtsgut schädigen wird« (BVerwG, zit. n. ebd., S. 202).
Bedeutsam ist die Unterscheidung zwischen »konkreter« und »abstrakter« Gefahr. Eine konkrete Gefahr bezieht sich auf den Einzelfall, bei dem eine hinreichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts besteht; demgegenüber gelten als »abstrakte Gefahren« solche allgemeinen Sachverhalte, bei denen eine bestimmte Schadenswahrscheinlichkeit besteht (ebd., S. 203). Das Polizeirecht kennt noch weitere Gefahrenbegriffe, etwa »gegenwärtige« oder »erhebliche« Gefahren. Diese Unterscheidungen sind von Bedeutung, weil das, was die Polizei tun darf – ihre »Befugnisse« – abhängig ist von der Art der Gefahr, die es jeweils abzuwehren gilt.
Die Auffassung, dass mit der Aufgabe der Polizei auch die Mittel an die Hand gegeben werden, diese Aufgabe zu erfüllen, ist längst veraltet (Schenke 2018, S. 17). Als Relikt aus diesen Zeiten kann die sog. »Generalklausel« betrachtet werden, die sich weiterhin in allen Polizeigesetzen findet. Sie lautet in der Formulierung des Musterentwurfs von 1986:
»Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§ 8a bis 24 die Befugnisse der Polizei besonders regeln.«
Diese Formulierung erlaubt der Polizei nur die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr einer konkreten Gefahr (»im einzelnen Falle«). Und sie begrenzt die Reichweite durch den Verweis auf die Sonderregelungen in den nachfolgenden Paragrafen. Dieser Nachsatz ist von besonderer Bedeutung, weil er die generelle Befugnis zur Durchführung »notwendiger Maßnahmen« auf solche beschränkt, die keinen Eingriff in die (Grund-)Rechte der BürgerInnen darstellen. Wenn die Polizei zur Gefahrenabwehr eine Wohnung betreten will, bedarf sie dazu einer gesetzliche Grundlage, denn es handelt sich um einen Eingriff in das Grundrecht auf die »Unverletzlichkeit der Wohnung« (Art. 13 GG); wenn die Polizei die Identität von Personen überprüfen will, bedarf sie dazu einer gesetzlichen Grundlage, weil es sich um einen Eingriff in Art. 2 GG (Allgemeine Handlungsfreiheit) handelt.
Ob es sich bei dem, was die Polizei tut, um einen »Eingriff« in geschützte Rechte handelt oder ob es als »schlicht hoheitliches Handeln« betrachtet wird, hängt von den rechtlichen Bewertungen ab, die sich historisch wandeln. Bis zum »Volkszählungsurteil« des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1983 galt z.B. die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die herrschende juristische Lehre und für die deutschen Gesetzgeber nicht als »Eingriff«, weshalb man auch neuere Instrumente polizeilicher Datenerhebung auf die Generalklausel stützte. Zu diesen neueren Instrumenten gehörte nicht nur die elektronische Speicherung und Verarbeitung der Daten, sondern auch ihre Erhebung durch verdeckte Methoden. Infolge des Volkszählungsurteils wurden die Einzelbefugnisse in den Polizeigesetzen erheblich ausgeweitet, um den nun schärfer gefassten »rechtsstaatlichen Ansprüchen« zu genügen. Trotz dieser anhaltenden rechtlich abgesicherten Befugniserweiterungen ist die Reichweite der Generalklausel – und damit die Frage, wo ein Grundrechtseingriff beginnt – dauerhaft strittig. Die Diskussion um die »Gefährderansprachen« ( 
Kap. 5
) ist ein aktuelles Beispiel für diesen Konflikt. Einzelne Befugnisse, soweit sie für das Verhältnis von Sozialer Arbeit zur Polizei von direkter Bedeutung sind, werden in Teil B genauer dargestellt.
1.1.2 Aufgaben im »Vorfeld«
Bereits seit den 1970er Jahren gab es Entwicklungen im Bereich der Polizei, die die Bindung polizeilichen Handelns an die »konkrete Gefahr« infrage stellten. Dies geschah im Kontext einer generellen Hinwendung zur Prävention, die im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts für viele Politikbereiche in den Vordergrund rückte. »Gefahrenabwehr« ist ihrer Natur nach präventiv ausgerichtet, mit dem Schutzgut der »öffentlichen Sicherheit« zählten auch alle Verstöße gegen die Rechtsordnung, also kriminelle Handlungen, zu den polizeilichen Aufgabenfeldern. Aber polizeirechtlich waren sie durch die »konkrete Gefahr« auf sehr enge Konstellationen beschränkt.
Читать дальше