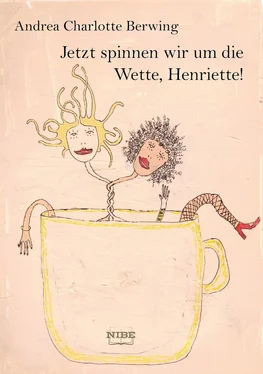„Und diese, meine alte Kultur, die hat sich weiterentwickelt und die brauchen wir jetzt! Ich habe lange genug diese Verbindung abgeschnitten und damit einen Teil von mir selbst. Damit ist jetzt Schluss!
Lea wird die Reise antreten, wenn Gott es will. Und nicht dein Allah.“
Nana erschrickt vor der Inbrunst ihrer Mutter und reißt die Arme erschrocken nach oben. So hat sie ihre Mutter noch nie erlebt. So überzeugt und aufgewühlt zugleich.
Lea, sich plötzlich sehr verlassen fühlend, versteht, dass sie reisen soll. Weit weg. In den nächsten Tagen nimmt sie ihre Matte und legt sich näher hin zum gelben Sand. Weg vom Haus und seinen Bewohnern. Es beunruhigt sie, dass die Gespräche sich um ihre Person drehen. Sie weiß das Haus mit den Gesprächen ihrer Großmutter und Mutter einige Meter weit weg und hofft, dass die Großmutter niemals eine Antwort aus Deutschland erhält. Niemals.
Der alte Mann über dem Neubau
Der Fahrstuhl fährt höher als das Haus, in dem Henriette wohnt, Stockwerke hat. In den dreizehnten Stock. Die Tür geht auf und ein alter Mann steht vor ihr. Henriette wagt es, einen Schritt auf ihn zuzugehen. Sie bewegt ihr rechtes Bein über den Spalt, der die wackelnde Fahrstuhlkabine vor der rettenden festen Etage trennt. Der Raum ist in weiches Licht getaucht. Licht, das den sakral wirkenden Raum noch größer erscheinen lässt. Und auch den Mann vor ihr. Groß und hager wirkt er, irgendwie mächtig. Er schaut Henriette sehr ernst an. Und murmelt Worte, spricht mit dem kleinen vorsichtigen Mädchen. Henriette nimmt an den Seiten antike Säulen und alte, wie mit Mehl befüllte Säcke wahr. Sie beschleicht ein Gefühl wie aus einem Märchen. Sie befindet sich in einer anderen Zeit, kann es nicht in Worte fassen und auch nicht in Gedanken. Staunend spürt sie hier das Verschmelzen von Zeit und Raum. Er könnte ihr Großvater sein; so hätte sie ihn sich vorgestellt. Er wirkt, als käme er aus einer anderen Welt zu ihr.
Dann wacht Henriette auf. In ihrem Bett. Das Kopfkissen ist unter ihren Bauch gewühlt, die Beine sind angezogen wie in einer Embryostellung. Gelbe Vorhänge hängen vor den kunststoffumrahmten Fenstern. Dahinter ist es dunkel. Kein einziges Sternenlicht zeigt sich. Henriette schläft wieder ein. Der gelbe Wellensittich neben ihr im abgedeckten Käfig, die kleinen knopfförmigen dunklen Augen verschlossen, ist ganz still. Das weiße Tuch bewegt sich nicht. Kein Luftzug bewegt sich in dem Betonzimmer. In einem Neubau gebaut in den Siebzigern. In Halle.
Am nächsten Morgen liegt eine Feder auf ihrem Kopfkissen; sie ist gelb, wie das Federkleid von Tschibi, ihrem Wellensittich. Sie öffnet den Käfig und hängt ihm einen Hirsekolben hinein. Der Stiel ist widerspenstig und zerbricht bei dem Versuch, ihn zwischen die dünnen Käfigstäbe zu flechten. Tschibi flattert aufgeregt hin und her. Henriette hält dem Wellensittich ihre kleine Hand vor den weichen gelben Bauch, Tschibi hackt einmal mit dem Schnabel in die Hand, wie um sich zu vergewissern, ob sie auch echt ist. Dann setzt er sich darauf. Die kleinen Krallen bohren sich in Henriettes Haut. Es piekst. Sie spürt das Gewicht von Tschibi und wundert sich, wie leicht er ist. Eigentlich nicht existent. Und wie sehr sich so ein kleiner Vogel in ihr Herz hineinkatapultiert hat.
Bevor ihr Vater, der nur jedes zweite Wochenende nach Hause kam, eines Abends erst den Käfig bedeutsam aus Zeitungspapier auswickelte und dann eine kleine Pappschachtel mit Löchern, in dem der kleine Vogel sitzt, aus seiner schwarzen Aktentasche hervorzauberte, versuchte Henriette selbst Eier auszubrüten. Sie stahl ihrer Mutter Hühnereier aus dem Kühlschrank, legte sich diese im Bett vorsichtig zwischen ihre Oberschenkel. Bevor sie sich für die Schule zurechtmachte, wickelte sie die Eier in ihren Schal und ihre Mütze. Sehr gespannt lief sie nach der Schule zu den Eiern, nur noch dieser eine Gedanke. So konnte sie es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Doch nie, nie krabbelte auch nur ein Küken heraus. Sie hielt die Eier an ihr Ohr, horchte, Stille. Sie befühlte sie, die glatte Oberfläche, kein Schnäbelchen pochte von innen an die dünne Wand. Die weißen Eierschalen starrten sie nur leer an. Doch die Vorstellung von einem eigenen Küken aus dem Ei bewahrte sich Henriette tapfer.
Henriette nimmt Tschibi nun vorsichtig mit ins Bad und setzt den kleinen Vogel dort auf die Spiegelablage. Dann wäscht sie sich zuerst das Gesicht und schaut in den Spiegel. Es klingelt an der Tür; Henriette hört, dass ihre Mutter zur Sprechanlage geht. Es brummt und knirscht laut, als sie sie bedient.
„Kommt Henriette runter?“ Lena, ihre blonde Freundin steht unten und möchte auf den Spielplatz gehen. Henriette erkennt ihre helle Stimme sofort.
„Nein, es ist doch noch viel zu früh, Henriette darf erst ab 11.00 Uhr raus!“ Die Mutter lässt den Knopf los und geht in die Küche. Ihre Schritte sind sehr fest für so eine kleine zierliche Person. Henriette schaut sich weiter im Spiegel an; sie hat blaue Augen, stellt sie immer wieder fest. Nicht so schöne braune wie Lena.
Krieg und Sehnsucht im Kopf
Die Hände der Großmutter klopfen den Stein ab, viele Steine für das neue Lagerhaus werden es bis zum Abend. Endlich ein Häuschen für Vorräte. Oft schon ist sie erschöpft und würde sich am liebsten zum Sterben niederlegen. Doch so leicht ist das nicht; ein bisschen noch, sagt sie sich, noch ein bisschen. Lea braucht mich noch. Dann schaut sie in die Wüste hinein, die unergründliche. Sandkorn für Sandkorn, hier und da ein Kaktus, diese Kargheit, diese überwältigende Weite, das soll ihre Zukunft gewesen sein? Die Wüste ihr Schicksal?
Erinnerungen überwältigen sie. Auch in Deutschland war es karg. Vor allem auf dem Standesamt. Auf dem Schreibtisch dort. Den wird sie nie vergessen. So als wäre es heute. Genau jetzt! So sehr sind die Bilder dieser Momente in ihrem Gedächtnis haften geblieben. Das jedoch lässt sich nicht vorschreiben, welche Bilder die Seele sehen will. Dieser abgedunkelte Raum im zweiten Stock des alten Gebäudes mit den hohen Fenstern, die Eiche davor. Ihre Blätter gelb und braun zotteln im Wind hin und her. Der Stift liegt akkurat neben der Heiratsurkunde. Daneben der Brief. Das Einverständnis ihres zukünftigen Mannes. Handgeschrieben. Inmitten von Blut und Hunger und Durchhaltevermögen. Das Letzte, was sie von ihrem Geliebten sieht: den Stahlhelm. Der wusste wahrscheinlich mehr von den Tagen an der Front und ihrem Werner als sie. Und dann die bedrückende Einsamkeit, sie ist verheiratet, endlich und doch ganz allein mit ihrer stillen Sehnsucht, die überall nagt. Und sie überallhin verfolgt.
Ja, er hat Briefe geschrieben, lange Briefe, sehnsuchtsvolle Briefe. Mit seiner schönen gestochen eleganten Handschrift. Ein Herz druntergemalt, unter seine Briefe. Ein Herz. Sein Herz. Das nie zurückkommen sollte zu ihr. Lange warb er um sie, geduldig. Fast fünf Jahre lässt sie ihn zappeln, werben. Werben um sie. Um eine gemeinsame Zukunft.
Werner, ihr erster Mann. Groß ist er und gutmütig. Zu gutmütig. Zu groß. Zu stark. Er hat die Pferde beschlagen, mit Eisen gearbeitet, später an der Front mit Kanonen. Genau als sie ihn am meisten liebt, wird er ihr entrissen. Durch ein Formular. Einzug an die Front. Für das Vaterland. Auf dem Standesamt dann der Helm, Hochzeit mit dem Stahlhelm. Einsamkeit. Ihre Schönheit wird ihr zum Verhängnis, scheint ihr gerade zum Fluch zu gereichen. Denkt sie manchmal. Später.
Nach dem Tod ihres Mannes an der Front interessiert sich Heinz für sie. Er stellt ihr nach. Er versucht sie zu schlagen, als sie ihn nicht einlässt. Doch die Tür ist schneller zu, den will sie nicht. Er sieht hässlich aus in seiner Uniform, hager, zu helle Augen. Irgendwie missgestaltet in ihren Augen. Es muss etwas mit Aufrichtigkeit zu tun haben. Sie sieht immer nur Werner, auch in ihrer Wohnung. Er verblasst nicht. Die Erinnerung bleibt stark. Heinz, erbost und in seiner Ehre verletzt, lässt ein paar Monate später ihre zwei Töchter abholen. Kraft seines Amtes. In ein Heim. Sie sieht sie nicht wieder. Auf dem Formular steht Erbschaden.
Читать дальше