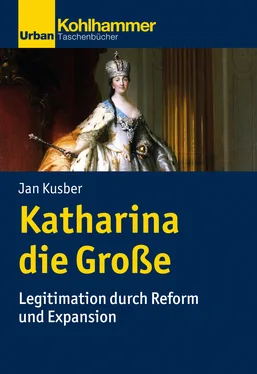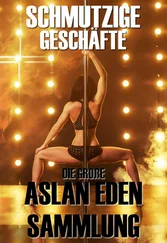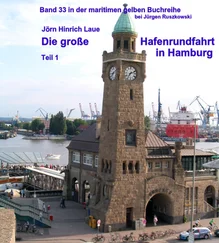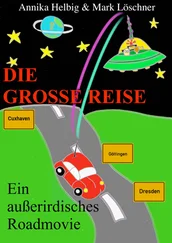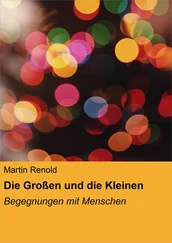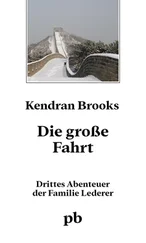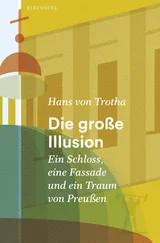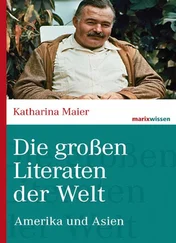1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Anders als Aleksej Razumovskij, der bei Hof populäre und innen- wie außenpolitisch neutrale langjährige Favorit Elisabeths, waren der Favorit der späten Jahre Ivan Šuvalov, vor allem aber sein Onkel Petr und der Vizekanzler Voroncov an politischer Macht ihrer eigenen Partei interessiert. Diese Gruppierung hatte ein Interesse daran, Bestužev zu stürzen, und den Anlass dafür bot der Siebenjährige Krieg. Der Großkanzler war einerseits habsburgisch orientiert, andererseits antifranzösisch eingestellt. Die französische Partei hingegen war in den ersten Jahren der Herrschaft Elisabeths stark gewesen, hatte sie doch den Staatstreich der Tochter Peters unterstützt. Ihr Leibarzt L’Estocq und der französische Gesandte, der Marquis de le Chetardie, standen für diese Hofpartei. Bestužev gelang es, diese Partei zu stürzen – le Chetardie musste das Land verlassen. Andererseits konnte er nicht verhindern, dass Russland im Renversement des Alliance 1756/57 der antipreußischen Allianz beitrat, 41zu verlockend erschien dem Petersburger Hof die Aussicht auf Gebietsgewinne im Westen im Falle eines Krieges gegen Preußen. Insbesondere hatte Elisabeth Semgallen und das Herzogtum Kurland in den Blick genommen, das bereits faktisch unter russischem Protektorat stand.
Bestužev war auf die antipreußische Linie eingeschwenkt, doch seine Gegner unterstellten ihm, einen Separatfrieden mit Preußen zu suchen, und sahen auch das Großfürstenpaar in seiner Gruppierung. Dafür sprachen Katharinas gute Beziehungen zum Großkanzler und die weithin bekannte Preußenliebe und Friedrich-Verehrung des Großfürsten Peter. Als nach der für Russland siegreichen Schlacht von Großjägersdorf in Ostpreußen der russische Kommandierende General Stepan Apraksin seinen Sieg nicht nutzte und statt die flüchtigen preußischen Truppen zu verfolgen, den Rückzug auf Tilsit antrat, wurden bei Hofe Gerüchte ausgestreut, er habe dies auf Geheiß des Großkanzlers und des Großfürstenpaares getan. Etwa gleichzeitig hatte die Kaiserin Elisabeth einen Schlaganfall erlitten, der die Fama nährte, Großfürst Peter oder gar seine Frau hätten die Absicht gehabt, nach dem Thron zu greifen.
Die genauen Hintergründe sind schwer zu eruieren. Bestužev jedenfalls stürzte und Michail Voroncov wurde neuer Kanzler. Katharina erschien ihre Situation so bedrohlich, dass sie zahlreiche Papiere verbrannte, von denen sie annahm, sie enthielten womöglich Kompromittierendes, weil sie politischen Inhalts waren. Dazu gehörte wohl auch ihr Selbstporträt, dass sie als Fünfzehnjährige geschrieben hatte. 42
Ende des Jahres 1757 und in der ersten Jahreshälfte 1758 erwartete sie ihren Fall. Sie bat die Kaiserin vorsorglich um Verzeihung für alle Ungelegenheiten und bat darum, nach Zerbst geschickt zu werden. Folgt man ihren Memoiren, überzog Elisabeth Katharina in einer Audienz mit dem Vorwurf des Verrats. Großfürst Peter bat seine kranke Tante, in sein Herzogtum Holstein ausreisen zu dürfen. Doch nichts geschah. Elisabeth schloss ihren Neffen nicht von der Thronfolge aus, Katharina wurde allmählich wieder in Gnaden aufgenommen, nicht zuletzt wohl auch, um als ein Gegengewicht zu Peter fungieren zu können. Der General Stepan Apraksin starb noch 1757, bevor ihm der Prozess gemacht werden konnte, und die russischen Truppen agierten weiterhin erfolgreich in der antipreußischen Koalition, besetzten 1758–1763 Königsberg und 1760 sogar für drei Tage Berlin. 43
Katharina verhielt sich nach dieser ihr bedrohlich erscheinenden Situation noch vorsichtiger als zuvor, um der nicht mehr vollkommen genesenden Elisabeth keinen Anlass zu geben, an ihrer Loyalität zu zweifeln. Ihr Mann Peter wurde über seine Mätresse durch den neuen Kanzler Voroncov gestützt; beide standen der einflussreichen Familie der Šuvalovs mit Distanz gegenüber, die bislang die innenpolitische Arena dominiert hatte. Petr Šuvalov war der erfolgreiche spiritus rector der Wirtschaftspolitik der Kaiserin Elisabeth, die in der Abschaffung der Binnenzölle kulminierte; Ivan Šuvalov war derjenige, der auf dem Feld von Kultur, Wissenschaft und Kunst der Herrschaft Elisabeths zu bleibendem Erfolg verhalf. Er kuratierte die 1755 gegründete Universität Moskau und stand Pate bei der Gründung der Akademie der Künste, die erfolgreich einheimischen Nachwuchs in bildenden Künsten und der Architektur hervorbringen sollte. 44
Die dominante Position dieser Familie bezog sich aber auch zunehmend auf den Bereich der Außenpolitik. Dies führte zu Allianzen, in denen Katharina, soweit erkennbar, trotz ihrer Vorsicht eine viel stärkere Position einnahm als ihr Mann. Die Großfürstin erwies sich im Stillen als eine ausgezeichnete Netzwerkerin. Ihre Befolgung der Gebote der Orthodoxie sicherte ihr das Vertrauen der Kirchenhierarchen. Wie die Kaiserin Elisabeth in ihrer Großfürstinnenzeit, knüpfte sie beste Kontakte zu den Garderegimentern, jenen Einheiten, die gewissermaßen aus den Spielzeugtruppen Peters des Großen hervorgegangen waren und die nach seinem Tode bei Thronrevolten eine Schlüsselrolle gespielt hatten. Ende des Jahres 1761 lernte sie Grigorij Orlov kennen, einen Gardeoffizier aus bester Familie, der ihr neuer Favorit wurde und mit seinen Brüdern die Unterstützung der Garden organisierte.
So galt vor dem Hintergrund der schwindenden Kräfte Elisabeths Großfürstin Katharina als Alternative zu Peter. Zwar divergierten die Meinungen – manche wie der Erzieher des Großfürsten Paul, Nikita Panin, 45sahen Katharina in der Position einer Regentin für ihren Sohn, andere sahen Katharina in einer noch abgeschwächteren Position als Vorsitzende eines Regentschaftsrates. Eine solche Konstellation erinnerte an die politische Situation, in der sich Elisabeth seinerzeit an die Macht geputscht hatte. Dritte sahen sie aber auch als Herrscherin des Russischen Imperiums.
In jedem Fall hatte Katharina ihre 18-jährige Großfürstinnenzeit, die sie in der Rückschau als eine Zeit der Langeweile beschrieb, als eine lange Schule mit Höhen und Tiefen durchlebt – nicht nur im Verhältnis zu ihrem Mann und der Kaiserin. Sie hatte gelernt, nicht nur aus Büchern zu lernen, sondern auch, wie sie Menschen unterschiedlichen Ranges in ihr Netzwerk einbinden konnte. Und sie hatte ein politisches Sensorium ausgebildet, das sie Situationen einschätzen ließ. 46Dies unterschied sie von Großfürst Peter.
Elisabeth starb am 25. Dezember 1761 (5. Januar 1762) im Alter von 52 Jahren nach 20-jähriger Herrschaft. 1Ihr Reich befand sich außenpolitisch in einem kostspieligen Krieg, Elisabeth selbst hatte auf großem Fuße gelebt, Hofhaltung und Baupolitik als Währungen der symbolischen Kommunikation hatte sie sich einiges kosten lassen. So starb sie im Aničkov-Palast an der Fontanka, ohne dass ihr Stararchitekt Rastrelli den Innenausbau des (vierten) Winterpalastes an der Neva, den sie im Stil des Barocks hatte bauen lassen, vollenden konnte. 2
Dies konnte symbolisch verstanden werden. Zwar hatte die Tochter Peters mit Hilfe ihrer kompetenten Berater die Reformen ihres Vaters gefestigt und fortgeführt, aber der Wandel war doch Stückwerk geblieben und der Siebenjährige Krieg belastete die Staatsfinanzen. Die Kaiserin selbst hatte sich zunehmend von der alltäglichen Regierung zurückgezogen, sich mit der Orthodoxie und Zerstreuung beschäftigt. Aufmerksam blieb Elisabeth, wenn es um Fragen der Nachfolge und des eigenen Machterhalts ging. Nach einer Verschwörung 1743 gleich am Beginn ihrer Herrschaft wich die Furcht vor einem Sturz nicht mehr; dies mag auch die Vorwürfe erklären, mit denen sie das Thronfolgerpaar der Verschwörung im Siebenjährigen Krieg bezichtigt hatte.
Großfürst Peter und Großfürstin Katharina waren am Sterbebett der Kaiserin. Nur wenige Stunden nach ihrem Tod nahm Peter, nun Kaiser Peter III., die Eidesleistungen der Ränge des Hofes, der Administration und des Militärs entgegen, ohne dass es zu Zwischenfällen kam. Sein Erzieher Jacob von Stählin wollte dies später als Akzeptanz gedeutet wissen. Ekaterina Voroncova-Daškova, 3eine Schwester der Mätresse Peters, zugleich aber Vertraute Katharinas, meinte sich in ihren 1804 erschienenen Memoiren an versteinerte Minen bei den Soldaten des Semjonovskij- und des Izmailovskij-Garderegiments zu erinnern. Offenen Protest gab es jedoch keinen. 4
Читать дальше