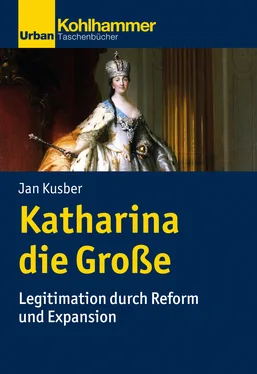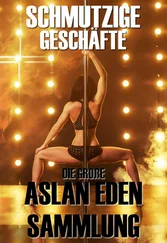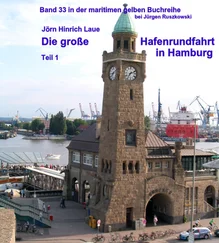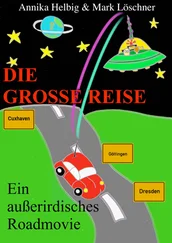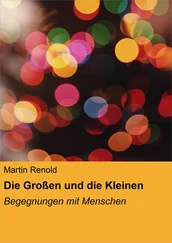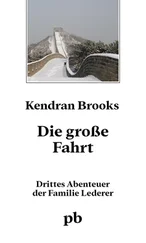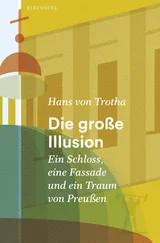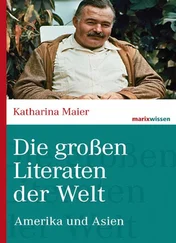1 ...7 8 9 11 12 13 ...19 Das Thronmanifest Peters III. aber konnte Katharina zu denken geben. Peter betonte, seiner verstorbenen Tante nacheifern zu wollen, vor allem aber »in allen Stücken in die Fußstapfen des weisen Monarchen, Unseres Großvaters Peter des Großen zu treten«. 5War diese Formel mehr, als die Konvention verlangte, da sich alle Herrscherinnen und Herrscher seit dessen Tod 1725 auf ihn bezogen hatten? Jedenfalls erwähnte Peter III. in seinem Manifest weder seine Frau Katharina noch den Sohn Paul.
Schon mehrfach ist angeklungen, dass Katharina ihren Mann in ihren Memoiren als einen infantilen, zur Trunksucht neigenden Menschen darstellte, der kein Interesse an ihr hatte und der sich ihr gegenüber abweisend verhielt. Ihre Erzählung über ihren Gatten sollte den neuen Kaiser regierungsunfähig erscheinen lassen. Schon die Zeitgenossen wunderten sich über Peter III., über seine Verletzung der Konvention, etwa über sein ungebührliches Verhalten bei der Überführung der Leiche seiner Tante, der verstorbenen Kaiserin, am 25. Januar 1762 in die Grablege der Romanovs in der Peter-und-Paul-Kathedrale in der gleichnamigen Festung: Durch Stoppen und schnelles Voraneilen ließ er den Trauerzug immer wieder auflaufen – denn der Kaiser gab die Geschwindigkeit der Prozession vor. Solche und andere Merkwürdigkeiten mochten je nach Standpunkt ungebührlich, närrisch oder parodistisch ausgelegt werden. In der jüngeren Geschichtsschreibung hat man Konventionsverletzungen Peters I. als eine bewusste Veränderung von Handlungsspielräumen interpretiert. 6Ob Peter III. ähnliches im Sinn hatte, ist schwer zu sagen; die Zeitgenossen deuteten seine Herrschaft, die nur wenige Monate andauerte, jedenfalls nicht so.
Die von ihm angeordneten Maßnahmen lassen aber keineswegs auf eine Regierungsunfähigkeit schließen. Die Herrschaft Peters III. war in ihrer Politik durchaus nicht so irrational, wie es Katharina ihren Korrespondenzpartnern und in ihrer Autobiografie späterhin hatte glauben machen wollen. 7Bei gleichzeitiger Heranziehung der Šuvalovs wie der Voroncovs vermochte er zu Beginn seiner Herrschaft durchaus verschiedene Hofparteien gegeneinander auszuspielen und sich eine eigene Position auszubauen, in der er sich freilich auf holsteinische Ratgeber stützte, die den russischen ruling families 8als fremd und homines novi galten.
Peter III. schaffte die Geheimkanzlei Elisabeths ab, aus der heraus die Kaiserin mögliche Gegner hatte verfolgen lassen. Sie hatte zwar in ihrer Regierungszeit kein Todesurteil vollstrecken lassen, was durchaus zu ihrem Nimbus unter den Untertanen beigetragen hatte. Dies hatte sie aber nicht daran gehindert, Gegner – etwa gestürzte Favoriten und Höflinge ihrer Vorgängerinnen – in die Verbannung zu schicken. Die Abschaffung der Geheimkanzlei schien den Höflingen Sicherheit zu bieten.
Mit dem Manifest vom 18. Februar 1762 verfügte der neue Kaiser etwas, worauf der Adel lange gewartet und gehofft hatte. Er schaffte die Dienstpflicht für den männlichen Adel ab, die Peter I. eingeführt hatte. Dies sollte ihm Unterstützung sichern, und die Risiken für den Staat waren gering. Zum einen hatten die Vorgängerinnen diese Dienstpflicht schon zeitlich begrenzt und zum anderen war die ›Verwestlichung des Adels‹ so vorangeschritten, dass er zumeist der Einkünfte aus dem Dienst bedurfte, um einen angemessenen Lebenswandel zu finanzieren. 9Zugleich setzte Peter das um, was in einer Gesetzkommission seiner Tante Elisabeth seit 1754 vorgedacht worden war. 10Ohne Dienst gab es keine Hofnähe und die war im Kampf um Macht und Einfluss elementar. Dieses vermeintliche Zugeständnis kostete also wenig, und Katharina sollte hieran nichts ändern.
Folgenreicher war sein Verhältnis zur orthodoxen Kirche. Nicht nur sein Verhalten bei Tod und Beerdigung seiner Tante galten als Verstöße gegen orthodoxe Konventionen, die Katharina tunlichst vermied. In ihren Memoiren unterstellte sie ihm Verrat am rechten Glauben, woraus die Unmöglichkeit seiner Herrschaft auf dem Thron folgte. Der Herrscher auf dem Thron Russlands musste orthodox sein. Jede Andeutung, der Herrscher wolle konvertieren, wie etwa in der Zeit der Smuta an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert, als man dem ›falschen‹ Zar Dmitrij unterstellte, katholisch zu sein und das Moskauer Reich dem Katholizismus zuführen zu wollen, führte zu seinem Fall. Katharina nutzte nun die Gelegenheit, Peters Verhalten gegenüber der Religion in diese Richtung interpretiert zu sehen. Die Konsekration einer lutherischen Kirche in Oranienbaum wollte sie damals wie später als einen Anschlag auf die Ikonen und überhaupt die Orthodoxie verstanden wissen. Plante Peter seine Rekonversion? 11
Dafür gibt es keine konkreten Hinweise, auch wenn er der Freimaurerei positiv gegenüberstand, den Katholizismus tolerierte und den Protestantismus förderte. Von religiöser Toleranz war im Zeitalter der Aufklärung auch unter Herrschern vielfach die Rede, wenngleich hierunter ganz unterschiedliche Dinge gefasst wurden. Friedrich der Große war hier erneut das Vorbild für Peter III. Auch Katharina folgte diesem Prinzip, freilich ohne die orthodoxe Geistlichkeit derart offensichtlich zu verprellen. Schlimmer noch als seine wohlwollende Haltung gegenüber den Lutheranern und Katholiken war in den Augen seiner Gegner ein Ukaz (Erlass), der die Altgläubigen betraf. Diese millionenstarke Gruppe war im Moskauer Reich des 17. Jahrhunderts durch die Kirchenreformen des Patriarchen Nikon entstanden und hatte zu einer Spaltung der Orthodoxie geführt, die über die bisher gekannten Sektenbildungen hinausging. Die Altgläubigen waren seitdem als Häretiker verfolgt worden, und auch Peter der Große, der sonst die verschiedenen Konfessionen und Religionen toleriert hatte, hatte sie gnadenlos verfolgen lassen. 12Am 29. Januar 1762 nun gab Peter III. bekannt, die Altgläubigen tolerieren zu wollen, 13und brachte damit den Klerus, an der Spitze Arsenij, den Metropoliten von Rostov, gegen sich auf.
Dieser Unmut steigerte sich, als der Kaiser im März anordnete, man solle den Klerus überwachen, ob er sich auch um die Schwachen und Bedürftigen kümmere. Der utilitaristische Blick auf die Funktion der Kirche, dem seines Großvaters nicht unähnlich, war ein Charakteristikum des Zeitalters, in dem die Aufklärung andernorts die geistlichen Fürstentümer und ihre Reichtümer oder die Jesuiten unter Beschuss nahm. Peter III. ging jedoch noch einen Schritt weiter. Diesen allgemeinen Antiklerikalismus aufgreifend wollte er die Geistlichkeit auf das verweisen, was ihr zukam: die geistliche Sorge um die Gläubigen – und dazu war materieller Besitz nicht nötig. Peter der Große hatte bereits ein Klosteramt gegründet, das die Einkünfte der Klöster hatte besteuern und damit für den Staat nutzbar machen sollen. Peter III. hatte nun vor, nach dem Kirchenland zu greifen und die Säkularisierung des Besitzes zu betreiben – Forderungen, die auch andernorts in Europa auf der Tagesordnung standen und die der Unterordnung der Kirche als synodale Behörde unter den Staat entsprach. 14Am 21. März 1762 befahl er die faktische Säkularisierung der Kirchenländereien durch ein neu eingerichtetes ›Ökonomiekollegium‹ und machte die Kirchenbauern damit zu Staatsbauern. 15Dass Katharina diesen Maßnahmen positiv gegenübergestanden haben muss, wird aus der Fortsetzung der Maßnahmen nach dem Sturz ihres Mannes deutlich.
Millionen von Kirchenbauern wurden zu Staatsbauern und dies war eine erhebliche Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, denn was nun wegfiel, war der Frondienst: Staatsbauern leisteten nur einen Zins an den Staat. Damit rief Peter III. Erwartungshaltungen bei den Bauern hervor, die sich aus seinem Adelsmanifest ableiteten. Wenn, so die Erwartung vieler Gutsbauern im adligen Besitz, der Dienst für den Adel aufgehoben wurde, sei auch eine Dienstverpflichtung für die Bauern nicht mehr gegeben – die Folge musste eine Gleichstellung mit den Staatsbauern oder aber eine generelle Aufhebung der Leibeigenschaft sein. Wenn Peter III. solches im Sinn gehabt hatte, ist es nicht überliefert. Die Erwartungen aber waren geweckt und mit ihnen sollte Katharina sich in ihrer Herrschaft auseinanderzusetzen haben.
Читать дальше