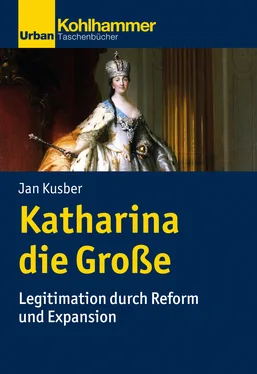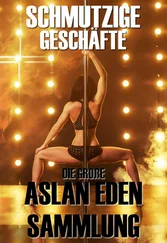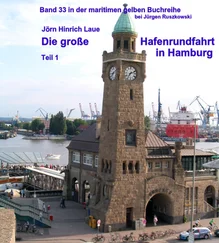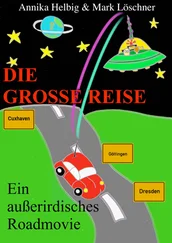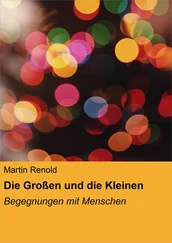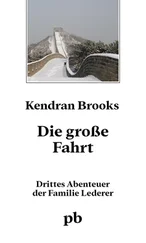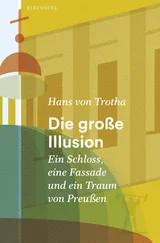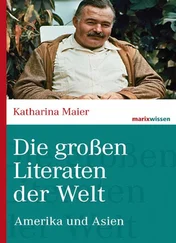Abb. 2: Anna Rosina Lisiewka, Das russische Thronfolgerpaar mit ihrem Sohn, Großfürst Paul (1756).
Katharina verbrachte die Zeit neben den Terminen des jungen und des großen Hofes vor allem mit Lektüre und ließ sich beraten, etwa 1755/1756 vom britischen Gesandten Sir Charles Hanbury Williams, der ihr Interesse an englischer Verfassung und Kultur förderte. 32Hatte sie schon in Deutschland wenn auch eher wahllos gelesen, suchte sie nun nach Lektüre, die sie auf ihre politische Aufgabe vorbereitete. Ihre Lehrer, alle Mitglieder der noch von Peter I. initiierten und 1725 gegründeten Russischen Akademie der Wissenschaften, machten ihr Vorschläge. So konnte sie in den langen Jahren ihrer Großfürstinnenzeit bis 1762 verschiedene Schichten von politisch relevanter Literatur zur Kenntnis nehmen. Dazu gehörte der gut eingeführte Bildungskanon antiker Literatur. Tacitus vor allem, so schrieb sie später, wäre eine Lektüre gewesen, die ihr den Weg öffnete für Werke, die sich mit dem Themenkreis Staat, Herrschaft und Individuum beschäftigten. Zu solchen gehörten auch Werke der älteren deutschen Staatsrechtslehre, etwa von Samuel Pufendorf, oder die Werke von dessen Zeitgenossen John Locke. Johann Heinrich Gottlob von Justis Staatswirtschaft oder systematische Abhandlung aller ökonomischen und Cameralwissenschaft, seit ihrem Erscheinen 1755 breit rezipiert, und andere seiner Werke, die in der ›guten Regierung‹ unterwiesen, standen auf ihrem Lektüreplan. Katharina wurde mit den ›Policeywissenschaften‹, wie sie in den Territorien des Heiligen Römischen Reiches und so auch in Zerbst in Herrschaft durch gute Ordnung übersetzt werden sollten, vertraut. Diese Grundlagen des Staatshandelns hatten schon Peter den Großen und seine Berater beeinflusst. 33Sie rezipierte aber auch das, was aus Frankreich kommend eine jüngere und vom konzeptuellen Zugriff her umfassendere Variante der Aufklärung darstellte, nämlich die Texte von Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu. Sein De l’esprit des lois (Vom Geist der Gesetze, Genf 1748) las sie nicht nur in ihrer Großfürstinnenzeit. 34Auch nach ihrem Herrschaftsantritt dachte sie anhand seiner auf John Locke basierenden Vorschläge zur Gewaltenteilung darüber nach, wie in Russland das institutionelle und praktische Verhältnis zwischen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Regierungsgewalt war und sich entwickeln sollte. Und mit Blick auf das vielfältige Geflecht des kaiserlichen Hofes, der mit seinem gewaltigen Personalbestand, seinen Amtsträgern aus Verwaltung, Militär und Hofdienst auch unübersichtlich sein mochte, war doch überdeutlich, dass die Gewalten in der Kaiserin als autokratischer Herrscherin zusammenfielen. Elisabeth mochte Aufgaben delegieren und dies tat sie im Verlauf ihrer Herrschaft zunehmend, aber sie behielt alle Gewalten letztgültig in ihrer Hand. Das autokratische Bewusstsein blieb. Hier sollte sich Katharina von keiner ihrer Vorgängerinnen im 18. Jahrhundert unterscheiden.
Katharina wusste über ihre Lektüren, dass es auch alternative Modelle der Organisation von Staat und Staatsgewalt gab. Auch interessierte sie sich für die praktische Seite der Gesetzgebung. Für das Strafrecht sollte für sie – dies freilich schon als Kaiserin – Cesare Beccarias Dei delitti e delle pene (Von den Verbrechen und von den Strafen, 1764) ein Referenzwerk werden, das ihr später durch den Kommentar Voltaires (1766) vermittelt wurde. Voltaire wiederum war gleichsam Pflichtlektüre. Seine Werke und die anderer Autoren, die an der Enzyklopädie mitwirkten, standen auf ihrem Programm. Daneben studierte sie die Bände des Dictionnaire historique et critique (1694–1697) von Pierre Bayle und setzte sich intensiv mit den Werken Friedrichs II. auseinander, über den sie wohl Niccolò Machiavellis Fürsten kennenlernte. 35
Sie selbst, aber auch Zeitgenossen berichteten von ihrem Lesefleiß – und sie begann zu schreiben. Auf Rat eines Bekannten noch aus Deutschland, des schwedischen Diplomaten Graf Gyllenborg, versuchte sie sich schon 1744 an einem Selbstporträt, das allerdings nicht überliefert ist. Sie begann Korrespondenzen zu führen, die nicht nur Alltägliches enthielten, sondern grundsätzliche Betrachtungen über Leben und Sein oder Staat und Gesellschaft. Vor allem Letzteres war nicht ohne Brisanz, denn sie war als Großfürstin eine politische Person und ihre Lektüre und ihr Agieren in der Lebenswelt des Hofes machten sie zu einer politischen Akteurin, die offensichtlich auf ihre Position bedacht war und bedacht sein musste.
Diese Lektüren kombinierte sie mit ganz praktischen politischen Erfahrungen. Immerhin war das Verhältnis zu ihrem Mann noch so gut, dass dieser sie 1755 bat, sich um die Angelegenheiten seines finanziell ruinierten Herzogtums Holstein zu kümmern, und sie widmete sich dieser Aufgabe gerne und intensiv. 36Regieren, dies war die Erkenntnis, die sie – im Gegensatz zu Peter – aus dieser Tätigkeit gewinnen konnte, bedeutete auch das intensive Studium von Papieren und Informationen, aufgrund derer Pläne gemacht und Entscheidungen getroffen werden konnten.
Daneben blieb Zeit für eine weitere Liebesaffäre: In der Entourage des englischen Gesandten befand sich der zwei Jahre jüngere polnische Magnatensohn Stanisław August Poniatowski, der sich in sie verliebte. 37Poniatowski, in der englischen Gesandtschaft nach St. Petersburg gekommen, war seinerseits hochgebildet und damit für Katharina ein Gesprächspartner, der ihr in mehrfacher Hinsicht all das bot, was ihr Mann ihr nicht bieten konnte und wollte. Der junge polnische Adlige war noch Jahre später fasziniert. Sie hatte eine Natur, so schrieb er in seinen Memoiren, die es ihr erlaubte, »von den allerunsinnigsten Späßen, den kindischsten Spielen in einem Moment zu arithmetischen Tafeln unerschrocken von der harten Arbeit oder den Texten« 38zu wechseln.
Im Dezember 1757 wurden Katharina und Poniatowski Eltern einer Tochter, Anna. Auch dieses Kind sollte Peter als das seine anerkennen, bevor es nach nur vier Monaten starb. Der Großfürst hielt es politisch für geboten, aus dem Verhältnis seiner Frau zu Poniatowski keinen Skandal zu machen, sorgte aber dafür, dass dieser den Hof verlassen musste. Ohnehin galt Poniatowski als Parteigänger der englischen Sache, da er im Gefolge des englischen Gesandten Charles Hanbury Williams nach St. Petersburg gekommen war, mit dem Katharina eifrig korrespondierte, 39während die Kaiserin Elisabeth ostentativ Distanz hielt. Williams’ Position wurde nach Ausbruch des Siebenjährigen Krieges nicht einfacher, und wie Poniatowski verließ er 1758 das Land. Poniatowski war über seine Verbannung vom Hofe zutiefst bestürzt und wollte, dass Katharina nun ihren Mann und Russland verließ und ihm auf seine Güter nach Polen folgte. Dies war aber offensichtlich keine Option für Katharina – sie hing an ihrer Position am Petersburger Hof und blieb. Poniatowski und Katharina blieben sich freilich auch in den kommenden Jahrzehnten verbunden.
Um diese Zeit entwickelte die Großfürstin auch ein gutes Verhältnis zum Kanzler des Russischen Reiches, Aleksej Bestužev-Rjumin, der sie offensichtlich darin ermutigte, eigene Machtoptionen auszuloten. 40Anders als ihr Mann erschien sie als eine politisch denkende und handelnde Person. Dies wurde umso interessanter, je kränker die Kaiserin Elisabeth wurde und je weniger sie in das alltägliche Regierungsgeschäft eingriff.
In den 1750er Jahren wurde die Familie der Šuvalovs bei Hofe immer einflussreicher. Um sie herum organisierte sich eine Hofpartei, die auch ein Interesse daran hatte, über die Aktivitäten des kleinen Hofes informiert zu sein. Es war ein strategischer Zug, dass Graf Andrej Šuvalov Kammerherr Katharinas wurde. Auf ihn gingen später erste europaweite Gerüchte über das zerrüttete Verhältnis des Großfürsten und der Großfürstin zurück. Šuvalov stand im Kontakt mit dem ebenso scharfzüngigen und sarkastischen James Boswell. Über diesen verbreiteten sich Gerüchte bis auf die britischen Inseln, dass Katharina Verhältnisse mit Sergej Saltykov und Poniatowski hatte und dass Peter Elisaveta Voroncova als Mätresse genommen habe.
Читать дальше